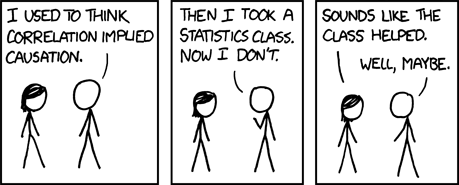2011 als Jubiläumsjahr — sein Geburtstag jährt sich zum 200. Mal — war der offensichtliche Anlass für diese Buch: Wolfgang Dömlings kleine Biographie “Franz Liszt”. Erschienen ist das in der von mir grundsätzlich sehr geschätzen Reihe “Wissen” des Beck-Verlags. Aber da passt dieses Buch kaum rein — im Gegensatz zu anderen dort erschienen Bändchen hat es mich sehr enttäuscht, obwohl es in der Taschenbuchkolumne der Süddeutschen Zeitung sehr direkt empfohlen wurde. Und zwar war ich sowohl inhaltlich als auch formal und sprachlich ziemlich enttäuscht.
Fangen wir mit dem pingeligsten an, den Formalalitäten: Entgegen der Reihen-Gepflogenheiten gibt es hier überhaupt keine vernünftigen Literaturhinweise: Dömling erwähnt den MGG-Artikel — und genau ein Buch. Das war’s auch schon — sehr enttäuschend. Und auch wenig hilfreich. Es gibt doch bestimmt auch gute musikwissenschaftliche, werkanalytische Literatur zu Liszt, die dem Leser etwas weiterhelfen könnte. Damit hängt vielleicht auch das inhaltliche Problem zusammen … — aber dazu später noch etwas.
Sprachlich fallen sofort die Satz-Ungetüme oder ‑Ungeheuer auf: Dömling häuft nämlich gerne in einem Satz alles an, was ihm so an Information über den Weg läuft — mit unzähligen Einschüben, Appositionen, Relativsätzen und so weiter. Und irgendwann, das ist bei ihm gar nicht selten, ist der ursprüngliche Satz gar nicht mehr zu erkennen. Ob der trockene, spröde Stil (der nur auf den letzten Seiten, wo es um Liszts Spätwerk geht, einige Funken schlägt) als Plus- oder Minuspunkt zu werten ist, bleibt sicher Geschmacksache. Ich fand es oft arg dürr.
Und inhaltlich? Das hängt durchaus wieder mit der sprachlichen Gestaltung zusammen. Dömling gibt sich gerne etwas besserwisserisch, etwas paternalistisch belehrend erzählt er den Lebensweg in groben (oft nur sehr bruchstückhaften) Umrissen, greift gerne mal auf das “wie bekannt” zurück. Dabei hat er offenbar durchaus den Laien im Blick, vieles musikfachliches wird von ihm nämlich gut und knapp erklärt, die fachlichen Voraussetzungen hält er ausgesprochen niedrig: Selbst eigentlich banale Dinge wie das Transponieren oder vom-Blatt-Spielen erklärt er mehrfach (aber wer eine Virtuosen- & Komponistenbiographie liest, wird solch elementare Sachverhalten doch wohl ungefähr parat haben …). Das sieht dann z.B. mal so aus:
1834 begegnete Liszt der Schriftstellerin George Sand (nom de plume für Aurore Dudevant), einer Frau, deren Klischeebild in der Nachwelt, besonders der deutschen, recht unfreundlich ist: als hosentragende, zigarren- und männerverschlíngende Emanze, die viele schlechte Romane geschrieben hat und nur als Pflegerin-Muse des unglücklichen Chopin in Erinnerung bleibt. (Eine der mit steter Regelmäßigkeit auftauchenden Kulturveranstaltungen in deutschen Städten heißt “Ein Winter auf Mallorca”, multimedial gestaltet mit einer Lesung aus Sands gleichnamigem Buch, mit Lichtbildern und mit Chopins Musik — darunter natürlich das “Regentropfen-Prélude”, das freilich als solches nur in der populären Überlieferung identifizierbar scheint …) Sand und Chopin lernten sich übrigens bei Liszt kennen. Der Winter auf Mallorca 1838/1859, worunter man sich heute vielleicht etwas “Rornantisches” vorstellt, war voller mehr oder weniger schrecklicher Erlebnisse. (Welch seltsame Idee ja auch, mit zwei Kindern und einem Pianisten und Komponisten, Großstadtmensch und krank dazu, sich im Winter auf eine unwirtliche und ungastliche Insel zurückzuziehen!)
Gut gelingt Dömling aber auch manches, vor allem die (musik-)historische Situierung und Einordnung Liszts, seiner Konzertpraxis und seiner Kompositionen. Das nimmt zar nur sehr wenig Raum ein, aber immerhin nimmt er sich die Zeit und den Platz — gerne auch mit entsprechenden Rückblicken, zu klar soll es ja nicht werden — zu schildern, was an Listzs Treiben Besonderheit oder Normalität im 19. Jahrhundert war — das ist ein sehr guter Zug.
Im ganzen wirkt das aber auf mich noch arg unfertig, wie eine Vorstudie für ein “richtiges” Buch: Dömling springt fleißig hin und her, ohne das immer ausreichend deutlich zu machen, beginnt irgendwie immer wieder neu. Deutlich wird das vor allem in seiner Darstellung der 1830er: Liszts Konzertkarriere darf hier unzählige Male neu beginnen — aber über das wie, das was und vor allem das warum erfährt man dann doch herzlich wenig. Überhaupt, der Konzertkünstler Liszt ist hier total unterbelichtet, gerade was die zeitgenössische Rezeption angeht, aber auch, was seine eigentlichen Unternehmungen betrifft.
Dazwischen, in dieser Materialsammlung oder diesem Steinbruch, stehen dann doch immer wieder kluge Sätze, die Einsicht und Einfühlungsvermögen verraten und den Leser wieder versöhnen. Schade nur, dass es so wenige bleiben und dass sie so verstreut sind. Seine Andeutungen haben aber irgendwie Methode: Das geschieht immer auf ähnliche Weise, wie z.B. Liszts Beziehung zu Wagner:
Cosimas detaillierte Tagebuchnotate sagen dazu mehr als genug.
Toll, dass Dömling das weiß. Ich hätte es auch gerne erfahren …
Mein Haupt-“Problem” bei der Lektüre des biographischen Abrisses aber: Mir scheint, er hat keine wirkliche Deutung des Lebens, keine Interpretation des Lebensweges — deswegen wirkt das so akademisch, weil er über große Teile des Textes nur die äußeren Stationen abhandelt, die Psychologie des Komponisten aber keine (bzw. nur eine kleine) Rolle spielt. Dazu kommt dann noch eine eher verwunderliche Zurückhaltung, was die Beschreibung und/oder Analyse der Musik Liszts angeht — das ist oft erschreckend und ärgerlich kurz, oberflächlich und nichtssagend. Von einem Musikwissenschaftler, der sich schon länger mit Liszt beschäftigt, hätte ich gerade in diesem Punkt deutlich mehr erwartet.
Also, in meinen Augen keine empfehlenswerte Biographie, auch im Jubiläumsjahr nicht: Wer noch keine Kenntnisse der Biographie Liszts hat, wird sich hiermit wohl schwertun. Und warum die Süddeutsche das empfehlenswert fand, erschloss sich mir überhaupt nicht.
Wolfgang Dömling: Franz Liszt. München: Beck 2011 (Wissen). ISBN 978–3‑406–61195‑7. 112 Seiten.