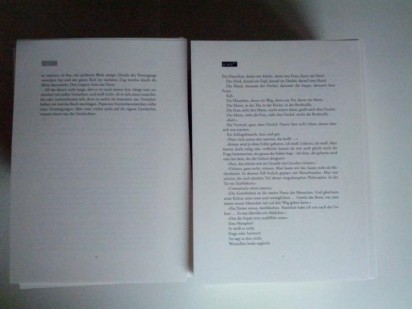Eine Auswahlausgabe der Gedichte Bobrowskis, die im Wagenbach-Verlag zum Verlagsjubiläum erschien und mich, da ich noch nichts von Bobrowski (außer seinem Namen) kannte, angelacht hat. Nach dem Lesen war das nicht mehr so sehr der Fall: Einen rechten Zugang habe ich nicht gefunden, die Lyrik Bobrowskis resoniert nicht so recht bei mir. Es ist eine ganz bestimte Art von Dichtung der und über Landschaften, was hier immer ganze Landschaften meint, mit ihren Leuten, Tieren und der Gegend – aber eben nicht nur die der Natur etc. Er beschreibt das weniger, sondern besingt die – auch schon zum Entstehungszeitpunkt – untergegangene, verloren gegangene Landschaften sehr poetisch und auch gewollt poetisch. Das klingt mir dann oft sehr emphatisch aufgeladen, in einer bewusst und gewollt artistisch überhöhten Sprache, die ihre (Landschafts-)Bilder immer geradezu zwanghaft metaphorisch und mythisch ergänzt bzw. überhöht – das passiert natürlich fast immer bei (guter) Landschaftsdichtung, fiel mir hier aber als besonders gesuchte Form sehr auf.
Das Sommerbuch von Tubuk-Deluxe. Und ein echtes Spätsommerbuch, das schon ein bisschen auf den Herbst einstimmt. Nagys „Stories“ sind wirkliche kurze Geschichten, die man kaum Erzählung nennen mag: Momentaufnahmen, fast lyrisch verdichtet, manchmal nur knappe zwei Seiten lang – aber immer sehr genau und präzise. Immer geht es hier um eine Art Leere, vor allem die emotionale. Auch eine gewisse Ortslosigkeit spielt da häufig mit hinein, die irgendwie mit der ungarisch-stämmigen Amerikanerin als Ich-Erzählerin (die Ähnlichkeiten mit der Autorin hat) zusammenhängt: Die „Unbehaustheit“ ist hier nicht nur (aber auch) metaphysisch, sie manifestiert sich hier immer wieder. Und dann ist da noch eine Art offene Traurigkeit, die die Stimmung der meisten Stories prägt. Auch in den Personenkonstellationen, dem Umgang der Personen miteinander, der fast immer beim Nebeneinander verbleibt, zeigt sich das immer wieder. So gibt es nur ganz wenige Gespräche, in denen Kommunikation wirklich gelingt. Die große Fremdheit geht aber noch weiter, sie umschließt auch das eigene Lebens und das eigene Selbst. Überhaupt ist (oder scheint?) immer alles schon länst vergangen und verloren – Zukunft gibt es nur ganz selten, Gegenwart auch nicht so häufig. Das ist dann nur in kleinen Dosen genießbar, sonst verliert man sich darin wie in einer bodenlosen Tiefe. Aber das ist auch kein Problem, die „Stories“ sind ja alle kurz und knapp.
Ein schönes Buch hat Pascal Mercier da geschrieben, über die Möglichkeit des rechten, richtigen und wahren Lebens. Und über die Tiefe der Seele. Und über die Möglichkeit, einen anderen Menschen kennen: Das Problem fängt ja schon beim Individuum selbst an: Kann man sich selbst kennen? Und kann man dann andere Menschen (er-)kennen? Und kann man Menschen nach ihrem Tod noch kennen lernen? In den Erinnerungen derer, die diesen Menschen überlebten? In seinen Taten? In seinen poetischen Erkundungen, seinen Notaten und seinen Niederschriften?
Das Leben ist nicht das, was wir leben; es ist das, was wir uns vorstellen zu leben.
Der Plot dafür ist manchmal etwas arg konstruiert für meinen Geschmack, und manchmal wird es auch etwas langatmig. Aber schön – nicht nur inhaltlich, auch gerade im sprachlichen Sinne – ist der Nachtzug nach Lissabon trotzdem.
Kitsch ist das tückischste aller Gefängnisse. Die Gitterstäbe sind mit dem Gold vereinfachter, unwirklicher Gefühle verkleidet, so daß man sie für die Säulen eines Palastes hält.