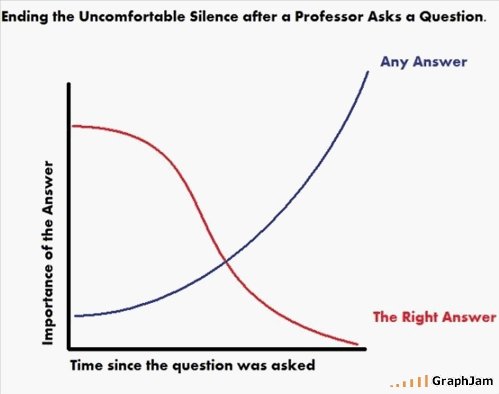ein herrlicher tag, der samstag. perfektes laufwetter. und die lust steigt mit jedem kilometer, den mich der zug näher nach erbach bringt.
irgendwann war’s dann endlich so weit, das mittagessen wenigstens halbwegs verdaut und die schuhe geschnürt. die meisten teile der insgesamt 31,58 kilometer bin ich schon irgendwann einmal gelaufen — aber noch nie in dieser kombination und teilweise auch nur in der gegenrichtung: dieses mal hatte ich mir nichts wirklich geplant, sondern schaute einfach mal, was mir so unter die füße kam.
kalt war’s zwar an einigen stellen ziemlich. vor allem da, wor noch schnee herumlag ;-). aber das stört ja nicht weiter …hauptsache es läuft. und das tat es. schön gemütlich hatte ich angefangen, über den anfang des dreiseentals zum buchwaldskopf, dann den üblichen weg über sonnenweg in richtung bullau eingeschlagen. davor habe ich aber noch einen abstecher gemacht und eine neue ecke ausgekundschaftet — schöne fichtenmonokultur, die aber aufgrund der hanglage noch recht viel sonne am nachmittag hatte. jedenfalls führte mich ein weiter bogen (bei dem ich nach einigen kilometern nicht mehr so genau wusste, wo ich eigentlich war) bis kurz vor bullau. von dort bin ich dann erst einmal hinüber nach würzberg gestürmt: langsam stieg das tempo, die erste hälfte lag ja inzwischen auch schon hinter mir. von würzberg aus bin ich schließlich schön quer wieder zurück zum ausgangspunkt des kutschenweges, allerdings ein bisschen unterhalb von diesem. dieses ganze hin und her hatte den eindeutigen vorteil, dass ich in den über zweieinhalb stunden kaum einem dutzend menschen begegnet bin. dafür hatte ich wunderschönen wald bei herrlichem sonnenschein und klarer luft für mich ganz allein. aber auch das hatte irgendwann natürlich ein ende: die letzte konzentrationsanstrengung, der schlechte hohlweg am waldrand beim buchwaldskopf — in der dämmerung nicht mehr ganz einfach, vor allem bergab bei hohem tempo — und schon lag das mümlingtal im sanften abendlicht — die sonne war kurz zuvor untergegangen — vor mir.
Jahr: 2008 Seite 2 von 14
am wochenende gelesen: thomas meineckes schmales bändchen feldforschung (frankfurt am main: suhrkamp 2006). der untertitel behauptet, das seien erzählungen. ich habe da so meine zweifel.
eigentlich war ich bisher von meineckes schriftstellerischen arbeiten immer recht angetan: tomboy habe ich vor einigen jahren mit großem vergnügen gelesen, dann auch holz und The church of John F. Kennedy sehr genossen. die voreinstimmung auf diesen band, der als &gdquo;narrativer Beitrag zur im AUgust 2006 eröffneten Aussetlung ‘das achte feld. geschlechter, leben und begehren in der kunst sein 1960’“ entstand, war also durchaus positiv. den hintergrund zitiere ich aus dem klappentext deshalb so ausführlich, weil er wahrscheinlich nicht ganz unwesentlich für die form des textes bzw. der elf stücke verantwortlich ist. vor allem aber, weil er so auffällig noch einmal das wort „narrativ“ bemüht. denn das ist eigentlich der knackpunkt bei diesem werk: wird hier überhaupt erzählt? ist es erzählen, wenn seitenlang die diskussion einer englischsprachigen mailingliste über drag queens und kings bzw. ihre zwischenstufen und überlagerunge und deren angemessene und korrekte bezeichnung zitiert wird? oder ist das zitat nur fiktion? die personennamen sind jedenfalls real und könnten auch — nach einer kurzen internetsuche — zu den entsprechenden aussagen passen. eigentlich ist es aber egal, denn die wirklichkeit ist offenbar nur noch der/ein/ text — und das heißt ja auch, dass wirklichkeit (und erst recht natürlich mimesis) kein kriterium mehr ist. also, die frage bleibt aber auch unabhängig von der fiktionalität dieser passage: was wird hier eigentlich erzählt? natürlich geht es um geschlecht(er), um ihrer konstruktion, wahrnehmung etc. — fast hätte ich geschrieben: das übliche meinecke-thema. aber noch einmal: ist das erzählt? es wir ja nur „be“-schrieben, nur situationen geschildert. nur ganz selten geschieht etwas, gibt es entwicklungen und nur in wenigen ansätzen gibt es so etwas wie zeit. und das scheint mir doch schon ein merkmal von erzählen zu sein, dass zeit in irgend einer form anwesend ist, eine rolle spielt. wenn überhaupt noch reste sozusagen von dem, was man geläufig unter erzählen fasst, zu finden sind, sind sie ganz meinecke-typisch neutralisiert1: das grundsätzliche präsens zum beispiel. die unklarheit von gender/sex der erzählstimme — wo es sie noch gibt. zum beispiel in mister gay, der rekonstruktion eines überfalls auf eine schwulenbar, bei der es natürlich auch wieder um die verschwimmenden grenzen geht: die übergänge von realität in fiktion, von bericht (dessen stilmittel vorherrschen) zur erzählung zum drehbuch, von psyschicher „normalität“ zu „krankheit“ usw. usf. oder, auch eine eher spezielle art des erzählens: odysee, wo der text nur noch aus einer zeittafel und der — deutenden — überschrift besteht.
da ließe sich bestimmt noch viel mehr dazu sagen. aber ob es sich lohnt? denn immer wieder dreht es sich aber — in dieser häufung dann auch schon sehr penetrant — um die unklarheiten des geschlechts, seine konstruktionen, seine identitäten (und deren konstruktionen)2 und so weiter: „schon als kleiner junge war sie“ (63). wer das aber kapiert hat — und die meinecke-leser kennen das ja eh’ schon -, dem ist eigentlich auch schon alles klar, was diese texte wollen. und der rest ist vor allem langweile.
gerade gesehen: peter kurzeck erhält den preis „hörbuch des jahres 2008“ — natürlich für „ein sommer der bleibt“. mit 15.000 euro auch ganz ansehnlich dotiert. herzlichen glückwunsch.
„die vergangenheit ist ein fremdes land. dort tun sie dinge anders.“ — leslie poles hartley, der zoll des glücks
eigentlich war gar nichts besonderes geplant und vorgesehen: der übliche samstägliche lange lauf war gar so lang, 24 km sollten es werden, mti einem tempo von 4:49 aber ohne rumtrödeln. aber irgendwie war der wurm drin, gestern vormittag.
über nacht war es kalt geworden, also habe ich zum ersten mal in diesem jahr die dickeren laufsachen aus dem schrank gesucht. ein wenig schnee lag noch auf den wiesen und äckern, auch auf den wegen. und ein kleines bisschen tanzte durch die luft. also zog ich los, ich hatte mir eine neue route aus mir bereits bekannten teilstücken überlegt. und das war sozusagen schon eines der probleme, denn meine schätzung ging nicht ganz auf. doch dazu später.
los ging’s wie immer in erbach mit den längeren läufen: erst einmal den buchwaldskopf hinauf. das hat den vorteil, dass man selbst im tiefsten winter schon mal warm gelaufen ist. dann bin ich ganz klassisch weiter über den sonnenweg auf den schmalen wanderweg richtung bullauer straße. und hier wurde schon klar, dass es heute nicht besonders einfach werden würde: tiefe schlammstellen säumten den weg immer wieder, versteckt unter einer schönen schicht bunten laubs. dazu noch eine dünne schneeschicht, die noch weniger untergrund erahnen ließ und dafür mit größerer rutschigkeit entschädigte: den erste beinahe-sturz konnte ich gerade noch abfangen. außerdem begann ich schon hier, nach gerade einmal vier kilometern, so richtig hunger zu bekommen. und der wollte einfach nicht verschwinden — bis zur rückkehr hat er mich dieses mal begleitet. aber noch war ich guten mutes und flotten schrittes unterwegs, machte den bogen an der bullauer straße und stürzte mich den kutschenweg in richtung würzberg hinauf. den verließ ich dann ungefähr auf halber höhe linker hand, um quer zum hang leicht ansteigend oberhalb von ebuch und ernsbach vorbeizuziehen. so langsam merkte ich das etwas hohe tempo, es wurde ziemlich anstrengend. mein gesamtschnitt lag aber immerhin schon bei 5:07 ungefähr. der änderte sich jetzt allerdings kaum noch, zumindest für einige kilometer nicht. noch etwas dämmerte mir so allmählich, je näher ich ernsbach kam: meine schätzung würde nicht ganz aufgehen, ich musste noch eine schleife einbauen. tatsächlich hatte ich, als ich dann am rand von würzberg aus dem wald kam, gerade einmal 12 kilometer auf dem forerunner — das war etwas wenig. vor allem angesichts der tatsache, dass ich mich mittlerweile ziemlich müde fühlte und das hohe tempo, dass jetzt eigentlich noch etwas schneller werden sollte, immer mehr mühe bereitete. aber ich quälte mich weiter und zog in richtung mangelsbach. hinter den häusern, auf dem limeswanderweg, begann dann das wahre leiden. ein baum lag quer auf dem eh’ schon sehr schlechten und außerordentlich matschigen weg (eher eine schlammpiste als ein richtiger wanderweg). also bin ich abseits des weges herumgerannt — und habe mir prompt zwischen becken und rippen einen querstehenden ast in die seite gerammt. die nächsten schritte waren nicht sehr angenehm, aber stehenbleiben kam nicht in frage … schnell wurde meine aufmerksamkeit aber wieder auf den boden gelenkt — oder das, was davon übrig blieb. hier war es nämlich so weich, dass ich fast steckenblieb. zumindest kam es mir so vor … der schlamm reichte bis ordentlich über die knöchel, meine füße wurden erst nass und dann kalt. aber mit einer kleinen tempoverschärfung auf dem dann mitten durch die bäume führenden schmalen wanderweg sorgte für rasche erwärmung. so gelangte ich dann immerhin noch halbwegs heil an die b47. die verließ ich dann bald wieder — heute hatte ich keine große lust auf straße, meine schuhe (die salomon 3d ultras) wollten so etwas nicht. also bin ich wieder auf den wanderweg eingeschwenkt. der führt hier direkt neben der straße einfach so durch die bäume, in schlangenlinien und hakenschlagend, ein schmaler trampelpfad eher als ein richtiger weg. natürlich war es nur eine frage der zeit, bis ich eine enge s‑kurve übersah — rumms, da war ich zu schnell und lag auf dem boden. aber nix passiert, schnell aufgerappelt und weiter gedüst. hinter eulbach wurde der weg — hinunter zum habermannskreuz — dann zwar breiter, aber auch wieder schlammiger. jetzt war es aber auch egal, der matsch hatte seinen weg in meine schuhe bereits gefunden. immerhin konnte ich das tempo jetzt langsam erhöhen und den schnitt schon einmal unter die 5:00-marke drücken. vorbei am habermannskreuz (wieder so ein lustiger pfad!) ging es weiter in richtung gräsig. und weil es noch nciht reichte mit den unanehmlichkeiten, musste ich unbedingt noch einmal hinfallen: langsam erschöpft achtete ich einen moment nicht auf den weg, stolperte mit dem rechten fuß gegen einen unter dem laub versteckten ast und konnte nicht mehr ausgleichen: patsch, schon hatte ich einen wunderschönen bauchplatscher in den schlamm gemacht. nur gut, dass ich schon fast zu hause war. die letzten zwei kilometer gingen auch noch irgendwie herum, sogar den kreuzweg bin noch hoch gekommen. zuhause sammelte ich dann erstmal dreck und blätter aus mir und meiner kleidung: bis in die unterhose hatte sich der kram vorgearbeitet … und dann waren es, trotz der schinderei, noch nicht einmal 24 kilometer geworden! — 23 km @ 4:50 — immerhin der schnitt ist in ordnung, einige höhenmeter waren ja schon dabei …
„Candy Store“ steht in großen Buchstaben über der Bühne geschrieben. Aber das ist irreführende Werbung. Denn was hier über die Bühne geht, ist alles andere als süß. Die niederländische Saxophonistin Candy Dulfer ist es, die mit ihrer Band den Frankfurter Hof aufmischt.
Nach längerer Abstinenz ist die Meisterin des Funk mal wieder in Mainz. Und kaum steht sie auf der Bühne, geht die Party auch schon los. Denn das ist nichts zum Zuschauen, jeder Groove geht in die Beine: Diese Funkattacke würde auch hartgesottene Partymuffel überwältigen – wenn denn welche da wären. Denn die Party findet nicht nur auf der Bühne statt, sondern auch davor. Kein Wunder – schließloich präsentieren sich die Musiker vom ersten bis zum letzten Ton energiegeladen und spaßgetrieben. Das ist sozusagen die perfekte Novembermusik.
Dafür bedient sich Candy Dulfer wieder einmal ausgiebig vom reichhaltigen Funkbuffett. Trotz der Fülle schmeckt es aber ausgezeichnet. Oder gerade deswegen. Denn das ist alles andere als ein chaotisches Sammelsurium. Sondern eine perfekt abgestimmte Menüfolge. Nicht ohne Verdienst daran ist die Crew, die die Chefköchin Dulfer unterstützt. Das Zusammenspiel ist ausgesprochen dicht. Deutlich wird das noch einmal, wenn sie für das Finale einen großartigen Groove über mehrere Minuten schön sorgsam von unten Stück für Stück, Instrument für Instrument aufbauen – da bleibt niemand unberührt, da kocht der Saal beinahe über. Es ist aber auch wirklich ein Groove der Extraklasse, der dabei herauskommt. Und damit passt er genau zum krönenden Abschluss. Denn wenn etwas bezeichnend für Dulfer und ihre Band ist, dann ist es die Fähigkeit, alles und jedes grooven zu lassen.
Ein bisschen etwas Wahres ist also doch dran, an der Verheißung eines „Candy Stores“: Denn die Menge an Zutaten, die vielen Auswahlmöglichkeiten, von denen sich Candy Dulfer und ihre Band bedienen könne, erinnern schon an die überwältigenden Möglichkeiten eines Süßwarenhandels. Einen Zuckerschock bekommt man davon allerdings nicht. Und außerdem ist so ein Konzert auch noch besser für die Figur.
(geschrieben für die mainzer rhein-zeitung). was nicht drin steht: der ziemlich mäßige sound im hinteren teil des saales — trotz oder wegen der ziemlich heftigen lautstärke …
Es war kein reines Zuckerschlecken, das zweite Sinfoniekonzert im Mainzer Staatstheater. Aber dafür ein großartiges Erlebnis. Und das aus vielen Gründen. Zum einen wäre da die Solistin, die Cellistin Tatjana Vassiljeva. Schon die ersten Töne des hochvirtuosen ersten Violoncello-Konzertes von Dimitri Schostakowitsch setzten Maßstäbe, denen Tatjana Vassiljeva auch durchweg gerecht wird. Der ganze erste Satz ist ein einziger atemloser Spurt, den die Russin mit grenzwertigem Druck und mit bis zum Zerreißen angespannter Konzentration absolviert. Über den stärker singenden, aber immer noch sehr fokussierten zweiten Satz bis in die funkensprühende Rasanz und kristallne Klarheit der Kadenz bis zur intensiven Dichte des Schlusses reicht die Anspannung in einem einzigen großen Bogen.
Der zweite Grund für das besondere Gelingen des Konzertes war das Philharmonische Staatsorchester. Denn die boten deutlich mehr als übliche Routine. Die klangliche Geschlossenheit und einsatzfreudige Hingabe, mit der die Musiker spielten, beflügelte nicht nur Schostakowitschs Konzert, sondern auch und vor allem die vierten Sinfonie von Jean Sibelius.
Und die führt auch schon direkt zum eigentlichen Zentrum des Abends: Arvo Volmer. Denn vor allem an ihm lag es, dass die vierte Sinfonie zu so einem Erfolg wurde. Ihm gelingt es nämlich scheinbar ohne besondere Anstrengung, die vielen, nach allen Seiten ausgreifenden Episoden dieser Musik immer fest zusammen zu schweißen. Und darüber hinaus, diese Einheit auch noch ganz natürlich und organisch wirken zu lassen. Das ist zwar in jedem Moment sehr gut bedacht, aber nie bedächtig. Denn auch wenn er sich durchaus Zeit für die genau ausgearbeitet Entfaltung der Musik und ihrer Form nimmt – langweilig wird das nie. Das liegt vor allem daran, die Einheit seiner Interpretation der inneren Logik der Sinfonie sehr genau folgt. Sie behauptet nie eine heile Welt, sondern vermittelt auf verblüffend deutliche und übersichtliche Weise ganz viel: Die Erfahrungen und Einsichten des Komponisten in den Zustand der Welt und das Wesen der Moderne. Das geht weit über bloß anregende Unterhaltung hinaus und ist alles andere als harmlose, beliebige Kunst – aber dafür umso lohnender. Vor allem, wenn es so deutlich und überzeugend musiziert wird wie im Staatstheater.
mal wieder ein neuer tee, natürlich von meinem lieblingsladen: chinesischer tee aus der provinz fujian: long yuan golden pekoe (needle-leaf). ein ziemlich interessanter tee, das. schon die farbe der teeblätter ist eher ungewöhnlich, so dunkel sind sie eher selten. und auch der fertige tee ist nicht gewöhnlich: ein tiefes, dunkles braun zeigt die tasse, mit verführerischem duft. und auch der geschmack ist nicht von schlechten eltern: intensiv und weich, anregend und erfrischend, mit einer deutlich ausgeprägten kakao-note — das hört sich seltsam an, schmeckt aber sehr harmonisch und bekömmlich. sicher nicht jedermanns geschmack. aber mir gefällts.
zubereitung: 15 g tee auf knapp 1,5 liter wasser, drei minuten ziehzeit (aber der tee verträgt sicher auch ein wenig mehr …)
so, ersteinmal der „offizielle” text, den ich für die mainzer rhein-zeitung geschrieben habe:
Motorräder kommen im klassischen Konzertleben recht selten vor. Aber andererseits sind auch Posaunenkonzerte im traditionellen Repertoire eher dürftig gesät. Was liegt also näher, als diese beiden Seltenheiten zur potenzierten Unwahrscheinlichkeit zu kombinieren?
Der Posaunist Christian Lindberg hat keinen Hinderungsgrund gefunden. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Um das „Motorbike Concerto” von Jan Sandström so richtig authentisch aufzuführen – schließlich ist es eigens für ihn komponiert worden – schlüpft er sogar in eine passende Motorradkluft. Nur das Motorrad fehlt also noch in der Rheingoldhalle. Aber zusammen mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und deren Dirigenten Ari Rasilainen entfaltete Lindberg immerhin eine täuschend echte Geräuschkulisse.Das Motorrad, das Lindberg hier eloquent und mit vollem Einsatz verkörpert, dröhnt und röhrt, quietscht und braust durch die diversen Landschaften. Sehr pittoresk ist das alles, serviert immer mit einem gehörigen Schuss Komik. Denn Sandström hat hier Programmmusik reinsten Wassers geschrieben. Bekanntermaßen ist ja ein Motorrad mehr als ein bloßes Fortbewegungsmittel, sondern ein regelrechter Lebensstil. Und auf Tour bekommt so einiges mit – so viel, dass auch das „Motorbike Concerto” noch nach allen Seiten von Eindrücken und Einfällen überquillt.1
Ganz im Gegensatz dazu dann der Klassiker überhaupt, Beethoven. Und gleich noch seine „Über&”-Sinfonie, die Fünfte. Hochtrabende und gewichtige Deutungen umranken und überwuchern das Werk seit der Uraufführung vor ziemlich genau zweihundert Jahren. Aber das schein Rasilainen gar nicht so sehr zu bekümmern. Ohne besonders übereifrige Überhöhung nimmt er sie erst einmal einfach als das, was sie schließlich ist: Musik. Und so offen bleibend, ohne der Vagheit anheim zu fallen, entwickelte die Staatsphilharmonie ein sehr geschlossenes Klangbild. Der Dirigent profilierte sich als fließender Erzähler, der ganze Lebensentwürfe und Geschichten entfaltet.2 Ohne Zweifel oder auch nur das leiseste Zögern überstehen die selbst die harten Konfrontationen mit der Realität im dritten Satz. Und immer wieder überwältigend ist natürlich die Wucht dieses unzerstörten Glaubens an die Kraft des Individuums, die das Finale unter der herrisch gebietenden Hand des Dirigenten entfaltet. Und auch wenn die Staatsphilharmonie ausgerechnet auf der Zielgeraden, in den letzten Takten, das Ende schon vorwegnimmt und deutlich an Präzision und Klarheit verliert, bleibt das Zusammenwirken aller Kräfte selbstverständlich immer noch triumphal – anders kann Beethovens Fünfte gar nicht enden.3