Nichts als Hoffnung (aber immerhin)
 Ein neues Tindersticks-Album ist ja schon ein Ereignis. Auch das fast mystisch schwebende und leichte No Treasure but Hope fällt in die Kategorie. Dabei ist es fast ungewöhnlich für ein Tinderstick-Album, weil vieles (nicht alles aber) etwas heller und freundlicher ist als auf älteren Veröffentlichungen. Natürlich bleibt Stuart Staples Stuart Staples, aber er klingt hier deutlich weltzugewandter, ja sogar freundlicher und locker(er), nicht mehr so angestrengt, schwer, gequält wie auf früheren Alben. Dabei bleibt die Musik irgendwie schon noch zwischne der Leiderschaft von Nick Cave und der Verzweiflung von Leonard Cohen angesiedelt.
Ein neues Tindersticks-Album ist ja schon ein Ereignis. Auch das fast mystisch schwebende und leichte No Treasure but Hope fällt in die Kategorie. Dabei ist es fast ungewöhnlich für ein Tinderstick-Album, weil vieles (nicht alles aber) etwas heller und freundlicher ist als auf älteren Veröffentlichungen. Natürlich bleibt Stuart Staples Stuart Staples, aber er klingt hier deutlich weltzugewandter, ja sogar freundlicher und locker(er), nicht mehr so angestrengt, schwer, gequält wie auf früheren Alben. Dabei bleibt die Musik irgendwie schon noch zwischne der Leiderschaft von Nick Cave und der Verzweiflung von Leonard Cohen angesiedelt.
Insgesamt wirkt das auf mich — nach den ersten paar Durchgängen — allerdings etwas flacher: Das ist mir oft zu ausgefeilt, klanglich zu detailverliebt, fast prätentiös. Da fehlt mir dann doch etwas Unmittelbarkeit — und damit genau jene Qualität, die mich an früheren Alben stark in den Bann gezogen hat: Die emotionale Stärke, die Unmittelbarkeit der Gefühle, die die (ältere) Musik immer wieder (und immer noch, das funktioniert auch nach Jahren des wiederholten Hörens noch, ich habe es gerade ausprobiert — und das zeigt die wahre Größe dieser Musik) auszeichnet, das fehlt mir hier. Vielleicht — das ist freilich nur eine Vermutung — sind Tinderstick einfach zu gut geworden. Das ist aber wahrscheinlich Blödsinn, auch die letzten Alben waren ja schon ausgezeichnet produziert.
Hier schlägt aber wohl doch stärker der Kunstwille durch. Und dafür sind die Formate der Popsongs dann aber doch wieder zu konventionell und deshalb zu schwach, das bleibt dann manchmal etwas schrammeling-mittelmäßig. Das heißt nun aber überhaupt nicht, dass No treasure but hope schlecht sei. Auch hier gibt es wunderbare Momente und schöne, erfüllende Lieder. “Trees fall” zum Beispiel, oder “Carousel” mit der typischen Tinderstick-Stimmung, der melancholischne Grundierung. Und auch “See my Girls” hat dann doch wieder sehr dringliche, intensive Momente (und eine schöne Gitarre). Das titelgebende “No treasure but hope” ist in der sehr reduzierten Konzentration auf Klavier und Gesang durchaus ein kleines kammermusikalisches, intimes Meisterwerk — und einfach schön.
Verspieltes Klavier
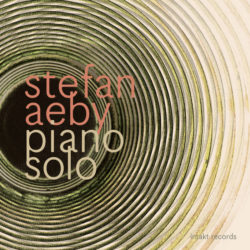 Stefan Aebys erste Soloaufnahme (soweit ich sehe zumindest), im letzten Jahr bei Intakt erschienen. Das ist, mehr noch als die Trioaufnahmen, im Ganzen oft sehr verspielt, aber insgesamt vor allem sehr harmonisch: klare Strukturen und klare Tonalitäten bestimmen den Gesamteindruck.
Stefan Aebys erste Soloaufnahme (soweit ich sehe zumindest), im letzten Jahr bei Intakt erschienen. Das ist, mehr noch als die Trioaufnahmen, im Ganzen oft sehr verspielt, aber insgesamt vor allem sehr harmonisch: klare Strukturen und klare Tonalitäten bestimmen den Gesamteindruck.
Besonders wird Piano solo aber vor allem durch den Klavierklang, das ist vielleicht, zusammen mit seiner klanglichen Imaginationskraft, Aebys größter Stärke. Denn der ist vielschichtig und feinsinnig, mit großem Nuancenreichtum. Hier kommt nun noch dazu, dass das Klavier von Aeby im Studio — er hat das wohl vollständig alleine aufgenommen — teilweise verfremdet, ergänzt und bearbeitet wurde.
Vieles ist dann auch — wie erwartet — sehr schön. Aber vieles ist auch nicht besonders überwältigend: So richtig umgehaut hat mich eigentlich nichts. Das ist solide, durchaus mit inspierten und inspierenden Momenten, überhaupt keine Frage. Mir scheint es aber insgeseamt einen Ticken zu banal, einen Tick zu flach in der oft ungebrochenen Schönheit, in der Suche nach Harmonie und Wohlklang. Dabei gibt es dann auf Piano solo auch viele Klangeffekte. Die machen das aber manchmal — und teilweise sogar über weitere Strecken — etwas arg künstlich für meinen Geschmack (“Dance on a Cloud” wäre dafür ein Beispiel). “Flingga” dagegen ist dann aber wieder herausragend: da kann sein runder, weicher, abgestimmter Ton sich voll entfalten.
Die Idee, den Klavierklang nicht alleine zu lassen, ihn aufzupeppen, zu erweitern, zu verfremden, ist ja ganz schön und nett. Aber das Ergebnis oder besser die Ergebnisse überzeugen mich nicht immer vollends. Vor allem scheint mir die klangliche Erweiterung oder Verfremdung nicht immer ausreichend musikalisch begründet und zwingend. Zumindest wurde mir das beim Hören nicht entsprechend klar. Und dann bleibt es halt vor allem eine (technische) Spielerei. Trotz alledem ist Piano solo aber dennoch eine definitiv schöne, überzeugende Aufnahme mit einnehmenden Klangbildern.
Die Winterreise als Gruppenwanderung
 Das ist Schuberts Winterreise — und auch wieder nicht. Denn sie ist — teilweise — für Streichquartett transkribiert und mit Intermezzi versehen von Andreas Höricht.
Das ist Schuberts Winterreise — und auch wieder nicht. Denn sie ist — teilweise — für Streichquartett transkribiert und mit Intermezzi versehen von Andreas Höricht.
Die Idee scheint ja erst einmal ganz vielversprechend: Die Winterreise — bzw. ihre “wichtigsten” (das heißt vor allem: die bekanntesten) Lieder — auf die Musik zu reduzieren, zum Kern vorzustoßen, den Text zu sublimieren. Das Ergebnis ist aber nicht mehr ganz so vielversprechend. Die Intermezzi, die zwar viel mit Schubertschen Motiven spielen und versuchen, die Stimmung(en) aufzugreifen, sind insgesamt dann doch eher überflüssig. Und die Lieder selbst: Nun ja, bei mir läuft mental dann doch immer der Text mit. Und es gibt durchaus schöne Momente, wo das Konzept aufzugehen scheint. Im ganzen bleibt mir das aber zu wenig: Da fehlt zu viel. Selbst eher mittelmäßige Interpretationen haben heute ein Niveau, das mehr an Emotion und Eindruck, mehr Inhalt und Struktur vermittelt als es diese Version beim Voyager-Quartett tut. Als bekennender Winterreise-Fan und ‑Sammler darf das bei mir natürlich nicht fehlen. Ich gehe aber stark davon aus, dass ich in Zukunft eher zu einer gesungenen Interpretation greifen werde …
Dreifache Freiheit
 Sowohl Kaufmann als auch Gratkowski sind Improvisatoren, deren Arbeit ich immer versuche im Blick zu haben. Sie verkörpern nämlich eine Form der improvisierten Musik oder des freien Jazz (oder wie immer man das genau klassifizieren mag), die verschiedene Aspekte vereint und zusammenbringt: Sie sind Künstler, die viel am und mit dem Klang arbeiten (gerade bei Achim Kaufmann fällt mir das immer wieder auf, wie klangstark er das Klavier zu spielen weiß) und zugleich im freien Improvisieren und Zusanmenspiel Strukturen entstehen lassen können, die das Hören spannend und überraschungsvoll machen. Das gilt auch für ihre Zusammenarbeit mit Wilbert de Joode, die auf Oblengths dokumentiert ist. Aufgenommen wurde ein Aben im Januar 2014 im Kölner Loft, veröffentlicht hat es das immer wieder und immer noch großartige Label Leo Records.
Sowohl Kaufmann als auch Gratkowski sind Improvisatoren, deren Arbeit ich immer versuche im Blick zu haben. Sie verkörpern nämlich eine Form der improvisierten Musik oder des freien Jazz (oder wie immer man das genau klassifizieren mag), die verschiedene Aspekte vereint und zusammenbringt: Sie sind Künstler, die viel am und mit dem Klang arbeiten (gerade bei Achim Kaufmann fällt mir das immer wieder auf, wie klangstark er das Klavier zu spielen weiß) und zugleich im freien Improvisieren und Zusanmenspiel Strukturen entstehen lassen können, die das Hören spannend und überraschungsvoll machen. Das gilt auch für ihre Zusammenarbeit mit Wilbert de Joode, die auf Oblengths dokumentiert ist. Aufgenommen wurde ein Aben im Januar 2014 im Kölner Loft, veröffentlicht hat es das immer wieder und immer noch großartige Label Leo Records.
Das beste an dieser Aufnahme ist die Kombination von gleichen oder ähnlicher Musizerweisen der drei Triopartner und der immer wieder überraschenden Vielfalt an konkreten klanglichen Ereignissen, die daraus entstehen. Da ist schon viel Geknarze, Gerumpel, Kratzen und Fiepen. Aber auch viel Wohlklang: Oblengths, das ist eine der großen Stärken dieses Trios, wartet mit einer ungewohnten Bandbreite vom Geräusch bis zum harmonischen Dreiklang und klassisch gebauten Melodien oder Motiven auf. Man merkt beim Hören aber eben auch unmittelbar, dass das hier kein Selbstzweck ist, sondern eingesetzt wird, um Zusammenhänge herzustellen und umfassenderen Ausdruck zu ermöglichen. Dazu passt auch, dass der Klangraum ein wirklich weites Repertoire umfasst und auch im leisen, vereinzelten, sogar im stillen Moment noch sehr ausdifferenziert ist. Ich würde nicht sagen, dass das Trio erzählt — aber irgendwie ergeben sich dann doch so etwas wie Geschichten, Abfolgen von Momenten, die zusammengehören und eine gemeinsame Struktur haben.









