 Beobachtend und erklärend geht es in Wir sind die Stadt! um den neuen Umgang mit der Stadt und ihren Räumen, um eine Art Re-Urbanisierung in der digitalen Moderne. Das ist ein bewusstes Lob der Stadt der Vielfalt, der vielfältigen (wechselnden, spontanen, instabilen) Koalitionen, die aber auch über sich selbst, über die Stadt hinaus reichen, denn: “In der Stadt gedeiht, wenn es gut geht, der Sinn für Staatlichkeit.” (149). Rauterberg hat, das gibt er auch zu, vor allem die neuen positiven Seiten der Stadt im Blick — die Möglichkeiten, die die digitale Moderne (also vor allem die Vernetzung im Netz und die Kommunikation mit Smartphones etc.) für eine Art Wiederbelebung städtischer Räume eröffnet. Er sieht und beschreibt eher die positiven Seiten der Veränderung der Stadt und des Lebens in der Stadt durch die digitale Moderne, ohne den Schatten aber ganz auszublenden. Sein Begriff der “Stadterquicker” (56) bringt es vielleicht am besten auf den Punkt: Er beobachtet eine neue Aneignung der Stadt, der urbanen Räume individuell im Kollektiv: “Die Stadt wird zum Raum für ein Ich, das sich ohne Wir nicht denken möchte.” (75) Und genau das geschieht nicht (mehr) vorwiegend planerisch gesteuert und auch nicht in erster Linie (wenn überhaupt) in institutionalisierten Formen (wie etwa Vereinen), sondern wesentlich fluider, schneller, spontaner, aber auch kurzlebiger. Die Offenheit des Raumes der Stadt und der Stadt ist dafür Voraussetzung und wird durch diese permanente Umwidmung, Aneignung, Inanspruch- und Inbesitznahme aber auch überhaupt erst konstituiert. Deshalb sieht Rauterberg in den aktuellen Tendenzen und Möglichkeiten eine neue, aktive und positive Chance für Urbanität: “Eine Stadt ist Stadt, wenn sie mit sich selber uneins bleibt.” (129)
Beobachtend und erklärend geht es in Wir sind die Stadt! um den neuen Umgang mit der Stadt und ihren Räumen, um eine Art Re-Urbanisierung in der digitalen Moderne. Das ist ein bewusstes Lob der Stadt der Vielfalt, der vielfältigen (wechselnden, spontanen, instabilen) Koalitionen, die aber auch über sich selbst, über die Stadt hinaus reichen, denn: “In der Stadt gedeiht, wenn es gut geht, der Sinn für Staatlichkeit.” (149). Rauterberg hat, das gibt er auch zu, vor allem die neuen positiven Seiten der Stadt im Blick — die Möglichkeiten, die die digitale Moderne (also vor allem die Vernetzung im Netz und die Kommunikation mit Smartphones etc.) für eine Art Wiederbelebung städtischer Räume eröffnet. Er sieht und beschreibt eher die positiven Seiten der Veränderung der Stadt und des Lebens in der Stadt durch die digitale Moderne, ohne den Schatten aber ganz auszublenden. Sein Begriff der “Stadterquicker” (56) bringt es vielleicht am besten auf den Punkt: Er beobachtet eine neue Aneignung der Stadt, der urbanen Räume individuell im Kollektiv: “Die Stadt wird zum Raum für ein Ich, das sich ohne Wir nicht denken möchte.” (75) Und genau das geschieht nicht (mehr) vorwiegend planerisch gesteuert und auch nicht in erster Linie (wenn überhaupt) in institutionalisierten Formen (wie etwa Vereinen), sondern wesentlich fluider, schneller, spontaner, aber auch kurzlebiger. Die Offenheit des Raumes der Stadt und der Stadt ist dafür Voraussetzung und wird durch diese permanente Umwidmung, Aneignung, Inanspruch- und Inbesitznahme aber auch überhaupt erst konstituiert. Deshalb sieht Rauterberg in den aktuellen Tendenzen und Möglichkeiten eine neue, aktive und positive Chance für Urbanität: “Eine Stadt ist Stadt, wenn sie mit sich selber uneins bleibt.” (129)
Bei dieser Art der Raumergreifung handelt es sich um weit mehr als eine Modeerscheinung oder das Freizeitvergnügen einiger Jungerwachsener der Mittelschicht. Es gäbe keine Wiederbelebung des öffentlichen Raums, würde sie nicht von einem breiten gesellschaftlichen Wandel der Idealbilder und Leitvorstellungen getragen. Wie weit dieser Wandel reicht, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass auch viele Stadtplaner ihr Verhältnis zum Raum neu bestimmen, auf eine Weise, die abermals an manche der Künstler und Architekten denken lässt. Das Prinzip der Offenheit und freien Aneignung, unvorhersehbar und ungehindert von äußeren Zwängen, ist mancherorts sogar zum neuen Leitbild der Planung avanciert. (37)
Die Stadt ist nicht länger Zone, sie darf wieder Raum sein, undefiniert. (39)
 Jetzt habe ich endlich auch mal ein Buch von Saša Stanišić. Vor dem Fest ist ein ganz interessanter und schöner Roman über Fürstenfelde, die Uckermarck, Deutschland und auch ein bisschen über die Welt. In kleinen, leicht auch zwischendurch und mit jederzeitigen Unterbrechungen konsumierbaren Häppchen-Kapiteln erzählt Stanišić ein Dorf und seine Bewohner in der ostdeutschen Provinz. Äußerer Anlass ist die Nacht vor dem großen Anna-Fest, in der die meisten noch eine oder andere Vorbereitungen für den nächsten Tag treffen. Zugleich weist der Text mit Quellenabschnitten weit in die Dorfgeschichte bis zum 16. Jahrhundert zurück — wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ernst gemeint ist: Die Sprache dieser (Pseudo-)Quellen scheint mir zu oft nicht ganz zeitgemäß, immer ein bisschen daneben, so dass ich das eigentlich als Fälschungen aus der Hand der “Archivarin” lese — dazu passt ja auch das große geheimnisvolle Getue, das um die Dorfchronik gemacht wird. Und dass es sie nicht geben kann, weil sie eigentlich dem Dorfbrand von 1742 zum Opfer gefallen ist. Egal: Das ist alles recht unterhaltsam und durchaus erhellend in seinen vielen Perspektiven, Stilen und Zeitebenen. Auch wenn ich manchmal den Eindruck hatte, die Idee — mit der Nacht vor dem “Fest” das Dorf, seine Gemeinschaft, seine Geschichte und auch noch die Weltzusammenhänge darzustellen — wird etwas überreizt. Unklar blieb mir zum Beispiel die Notwendigkeit, das auch noch auf die Tierwelt auszudehnen …
Jetzt habe ich endlich auch mal ein Buch von Saša Stanišić. Vor dem Fest ist ein ganz interessanter und schöner Roman über Fürstenfelde, die Uckermarck, Deutschland und auch ein bisschen über die Welt. In kleinen, leicht auch zwischendurch und mit jederzeitigen Unterbrechungen konsumierbaren Häppchen-Kapiteln erzählt Stanišić ein Dorf und seine Bewohner in der ostdeutschen Provinz. Äußerer Anlass ist die Nacht vor dem großen Anna-Fest, in der die meisten noch eine oder andere Vorbereitungen für den nächsten Tag treffen. Zugleich weist der Text mit Quellenabschnitten weit in die Dorfgeschichte bis zum 16. Jahrhundert zurück — wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ernst gemeint ist: Die Sprache dieser (Pseudo-)Quellen scheint mir zu oft nicht ganz zeitgemäß, immer ein bisschen daneben, so dass ich das eigentlich als Fälschungen aus der Hand der “Archivarin” lese — dazu passt ja auch das große geheimnisvolle Getue, das um die Dorfchronik gemacht wird. Und dass es sie nicht geben kann, weil sie eigentlich dem Dorfbrand von 1742 zum Opfer gefallen ist. Egal: Das ist alles recht unterhaltsam und durchaus erhellend in seinen vielen Perspektiven, Stilen und Zeitebenen. Auch wenn ich manchmal den Eindruck hatte, die Idee — mit der Nacht vor dem “Fest” das Dorf, seine Gemeinschaft, seine Geschichte und auch noch die Weltzusammenhänge darzustellen — wird etwas überreizt. Unklar blieb mir zum Beispiel die Notwendigkeit, das auch noch auf die Tierwelt auszudehnen …
Sehr gut gefallen hat mir aber der spielerische Umgang des Erzählers mit seinem Text: Zum einen produziert das Fabulieren hier selbst Fragen an den eigenen Text, die auch Teil des Textes werden und bleiben. Zum anderen ist da dieses inklusives “Wir” des Erzählers als dem Vertreter der Dorfbevölkerung, das also den Erzähler zu einem Teil seiner Geschichte macht und zumindest behauptet, dass hier nicht von einer Außenposition erzählt wird (auch wenn es einige wenige Hinweise auf eine Differenz gibt …). Aber, das ist interessant, dieses “wir” gilt nicht nur der derzeitigen Dorfgemeinschaft, sondern der aller Zeiten. Überhaupt ist Vor dem Fest mit seiner erzählerischen Lust und Begeisterung ein etwas kapriziöser Text, der sich selbst nicht übermäßig ernst nimmt, sondern Spaß am eigenen Erzählen und Erfinden hat und auch gerne das eigene Erzählen einfach miterzählt.
Der Fährmann hat einmal erzählt, es gebe im Dorf jemanden, der mehr Erinnerungen von anderen Leuten besitze als Erinnerungen, die seine eigenen sind. Das Dorf hat sofort geglaubt, er meint Ditzsche. Könnten aber andere gemeint gewesen sein, meinen wir. (233)
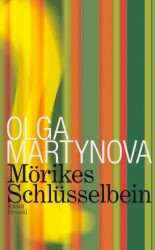 Mörikes Schlüsselbein ist so etwas sieein Wundertüten-Text: Der ganze Roman quillt über. Das fängt schon “vor” dem Roman an, mit der Überfülle an Paratexten, vor allem den extrem vielen Motti auf verschiedenen Ebenen des Textes, die oft auch noch nicht allein, sondern gleich zu mehreren auftreten. Und es geht im Text weiter, mit seiner etwas hypertrophen Fülle an Stilmitteln und auch an Themen. Insgesamt präsentierte Mörikes Schlüsselbein sich mir als ein ziemlich umher irrender Roman. Ich hatte immer wieder den Eindruck, der Text sucht seine/eine Stimme, da wird ausprobiert und verworfen, dass es eine Freude ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich Martynovas Erzählerin sehr von ihren Figuren (und davon gibt es eine ganze Menge) und ihrem Eigenleben treiben lässt — so war zumindest mein Eindruck.
Mörikes Schlüsselbein ist so etwas sieein Wundertüten-Text: Der ganze Roman quillt über. Das fängt schon “vor” dem Roman an, mit der Überfülle an Paratexten, vor allem den extrem vielen Motti auf verschiedenen Ebenen des Textes, die oft auch noch nicht allein, sondern gleich zu mehreren auftreten. Und es geht im Text weiter, mit seiner etwas hypertrophen Fülle an Stilmitteln und auch an Themen. Insgesamt präsentierte Mörikes Schlüsselbein sich mir als ein ziemlich umher irrender Roman. Ich hatte immer wieder den Eindruck, der Text sucht seine/eine Stimme, da wird ausprobiert und verworfen, dass es eine Freude ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich Martynovas Erzählerin sehr von ihren Figuren (und davon gibt es eine ganze Menge) und ihrem Eigenleben treiben lässt — so war zumindest mein Eindruck.
Auf jeden Fall ist das virtuos erzählt — aber was wird eigentlich erzählt und warum? Die Frage stellt sich schon früh beim Lesen, bis zum Ende habe ich keine richtige Antwort gefunden (auch in den Rezensionen übrigens nicht …). Das hängt natürlich damit zusammen, das Mörikes Schlüsselbein ein Episodennetz ohne Zentrum und ohne Rand ist, dessen Zusammenhänge teilweise bewusst unklar bleiben. Da fühlt man sich manchmal etwas verloren im Text — was, um es noch einmal zu sagen, nicht heißt, es wäre ein schlechter Text: vieles gefällt (mir), vieles ist gut, geschickt und sehr überlegt gemacht. Nur sehe ich kein Ziel außer dem Zeigen der Ziellosigkeit, dem Vorführen des Fehlens von (verbindlichen) Zielen und Zusammenhängen. Vielleicht habe ich auch schlecht gelesen, nämlich mit mehreren (ungeplanten) Unterbrechungen, die mich zu viel verlieren ließen?
So lese ich Mörikes Schlüsselbein als ein Spiel mit den Grenzen von Realitäten und Wahrscheinlichkeiten (die seltsamen Zeitreisen- bzw. Zeitvektoren-Episoden, die so irrlichternd in den Text hineingeschichtet sind, verdeutlichen das vielleicht am besten). Überhaupt spielt der Roman auf allen Ebenen, vom Zeichen (bzw. seiner typographischen Repräsentation, etwa mit unterschiedlichen Schwarzsättigungen …) bis zur Makroform (deren Struktur ich überhaupt nicht verstanden habe …). Und die Motti nicht zu vergessen, die auf verschiedenen Ebenen den Text sehr reichhaltig zieren. Und irgendwie, das macht Mörikes Schlüsselbein doch immer wieder interessant, gelingt es Martynova, damit (fast) das ganze 20. Jahrhundert zu erzählen, mit der Geschichte Deutschlands, dem Zweitem Weltkrieg, USA, UdSSR bzw. Russland und dem Kalten Krieg etc. pp. Und noch die abenteuerlichsten Kuriositäten werden von Martynova erzählt, als seien sie das normalste auf der Welt: Klar, das zeigt (wieder mal) den Verlust (allgemeingültiger) Maßstäbe: alles gilt (gleich viel) — aber war es das schon? Oder will der Text noch mehr? — Da bin ich ratlos. Ratlos übrigens auch beim Klappentext — ob der absichtlich so blödsinnig-nichtssagend ist? Eigentlich habe ich vom Droschl-Verlag eine bessere Meinung. Aber diesen Text als einen „Roman über Familie und Freundschaft: liebevoll, weiblich, scharfsichtig und humorvoll“ zu charakterisieren kann ja nicht wirklich ernst gemeint sein. Sicher, humorvoll ist der Text, das Lesen macht immer wieder große Freude. Aber was ist daran bitteschön weiblich?
Wenn man Wolkenkratzer mit Kathedralen vergleicht, meint man irrtümlicherweise in erster Linie ihre gesellschaftliche Bedeutung: Macht und Reichtum, die über das Leben der gemeinen Menschen emporragen. Aber sie haben eine architektonische Funktion: die Menschen dazu zu bringen, den Blick zum Himmel zu erheben. Dazu nützt irgendeine schöpferische Kraft die Macht, den Reichtum und die wandernden Bauleute, dachte Marina und hörte die Fetzen einer (oder mehrerer) osteuropäischer Sprache(n), bedrohliche Zartheit in den gedehnten Lauten. (165)
 Dietmar Daths Schaffen kann ich in seinen Verästelungen – ich kenne weder einen anderen Autor, der so vielfältige Themenfelder beackert noch bei so vielen unterschiedlichen Verlagen veröffentlicht – kaum noch nachvollziehen. Aber wenn ich dann ab und an wieder etwas aus seiner schwer beschäftigten Feder lese, ist es immer wieder überraschend und erquickend. Das gilt auch für Leider bin ich tot. Der Text hängt irgendwo zwischen Science-Fiction, Wissenschaftsthriller, politischem Roman, Krimi und was weiß ich noch alles. Genauso “wild” ist auch die erzählte Geschichte, die sich kaum vernünftig zusammenfassen lässt (und ohne wesentliche Plottwists zu verraten schon gar nicht …, ziemlich gut macht das Sonja Grebe auf satt.org). Es geht um höhere Intelligenzen, um Religionen und Götter, auch um Terror und Gewalt in allen möglichen Formen. Und ganz wesentlich auch um Zeit, um die Zeit — es zeigt sich nämlich, dass manche Figuren in Leider bin tot die Zeit aus ihrem Strahlendasein befreien können und eine Zeitschleife in Form eines Möbiusbandes schaffen. Das bringt nicht nur so einige neue Möglichkeiten, auch der Manipulation, ins Spiel, sondern sorgt auch für reichhaltige Verwirrungen und Irrlichtereien.
Dietmar Daths Schaffen kann ich in seinen Verästelungen – ich kenne weder einen anderen Autor, der so vielfältige Themenfelder beackert noch bei so vielen unterschiedlichen Verlagen veröffentlicht – kaum noch nachvollziehen. Aber wenn ich dann ab und an wieder etwas aus seiner schwer beschäftigten Feder lese, ist es immer wieder überraschend und erquickend. Das gilt auch für Leider bin ich tot. Der Text hängt irgendwo zwischen Science-Fiction, Wissenschaftsthriller, politischem Roman, Krimi und was weiß ich noch alles. Genauso “wild” ist auch die erzählte Geschichte, die sich kaum vernünftig zusammenfassen lässt (und ohne wesentliche Plottwists zu verraten schon gar nicht …, ziemlich gut macht das Sonja Grebe auf satt.org). Es geht um höhere Intelligenzen, um Religionen und Götter, auch um Terror und Gewalt in allen möglichen Formen. Und ganz wesentlich auch um Zeit, um die Zeit — es zeigt sich nämlich, dass manche Figuren in Leider bin tot die Zeit aus ihrem Strahlendasein befreien können und eine Zeitschleife in Form eines Möbiusbandes schaffen. Das bringt nicht nur so einige neue Möglichkeiten, auch der Manipulation, ins Spiel, sondern sorgt auch für reichhaltige Verwirrungen und Irrlichtereien.
Außerdem steckt in Leider bin ich tot – und darin ist es ein typischer Dath-Roman – ganz viel Gegenwartsbeschreibung und ‑diagnose. Der Autor hat einen scharfen Blick, er sieht und erkennt unheimlich viel und kann es in seinen Roman – mal eleganter, mal etwas plumper – alles hineinpacken. Der Verlag behauptet im Klappentext zwar, das sei eine “Meditation”, aber das halte ich für Unsinn. Dafür ist das Buch schon viel zu actiongeladen. Sicher, es wird viel gedacht und viel über philosophische, theologische, erkenntnistheoretische Probleme geredet. Aber das ist nur eine Ebene des vielfältigen Textes. Die Vielfalt ist eh Dath-typisch. Genau wie das zunächst ganz realistisch erscheinende Erzählen, das sich dann nach und nach leicht verschiebt, immer verschrobener wird und immer etwas verrückter, grausamer und berechnender (im technischen Sinn). Und Bücher, die ihren Autor selbst so wunderbar unernst-selbstironisch auftreten lassen, sind sowieso meistens ein großes Vergnügen. Und das gilt für Leider bin ich tot auf jeden Fall.
»Krieger. Leute im Krieg. Die nur verkleidet sind als Künstler oder Intellektuelle. Nicht? Wir sind … wir müssen immer die Besten sein. Die Schönsten, die Unwiderstehlichsten. Wir sind Klugscheißer und Zauberer und Träumer. Wir sind Rechthaber, weil wir …«
»Verletzte sind.« (63)
Noch ein erstaunlich spannender und interessanter Zufallsfund. Ich muss gestehen, dass mir Urs Jaeggi, der als Soziologe auch immer wieder belletristisch tätig war, bis dato unbekannt war. Das ist schade, denn Brandeis ist nicht nur ein faszinierender Zeitroman, sondern auch ein ausgesprochen guter Roman. Brandeis, die Hauptfigur und Erzählerstimme, aus deren personaler Perspektive alle drei Teile erzählt werden, ist sozusagen das alter ego des Autors: Soziologie, der zu Beginn noch in der Schweiz (in Bern) lehrt, dann an die neugegründete, noch zu bauende bzw. im Aufbau begriffene Universität in Bochum berufen wird, einige Zeit als Gastdozent in New York weilt und zum Schluss (“Berlin 1977”) in Berlin einen Soziologie-Lehrstuhl innehat — die äußeren Stationen entsprechen Jaeggis Karriere genau. Das aber nur nebenbei.
Interessant ist anderes. Brandeis ist ein politisch aktiver, empirisch arbeitender Soziologe, der sich aus einer dezidiert linken (marxistischen) Position auch und vor allem sehr intensiv mit seinen Studierenden und ihrem Blick auf die Welt und Gesellschaft auseinandersetzt. Das ermöglicht zum einen eine spannende Darstellung der Konflikte am Ende der 1960er Jahre an den Hochschulen (aber auch einen Blick auf die Differenz der dortigen Diskussionen und Situationen zu den Gegebenheiten der Arbeiterschaft, etwa bei den Bochumer Opel-Werken) über die Entwicklung zum linksradikalen Terrorismus und den Vietnamkrieg bzw. dem Kampf gegen den Krieb bis zu den amerikanischen Bewegungen Anfang der 1970er Jahre wie Black power und Feminismus. Und es gibt dem Autor einen sehr klugen, analytischen Erzähler, der bei seinem Blick auf die Welt auch die eigenen Position und deren theoretische Voraussetzungen immer wieder mitbe- und überdenkt. Äußerlich passiert dann gar nicht so sehr viel, es wird vor allem geredet und diskutiert, gestritten und demonstriert, analysiert und erklärt.
Der zweite, sehr interessante Punkt ist die Form von Brandeis. Die ist nämlich für die Entstehungszeit — der Roman ist immerhin schon 1978 erschienen — erstaunlich avanciert und auf der Höhe der Zeit. Und es zeigt sich auch, dass sich in den Jahrzehnten seither bei den zur Verfügung stehenden Mitteln für Prosatexte erstaunlich wenig getan hat. Brandeis ist genauso fragmentiert wie ein ordentlicher postmoderne Roman der Gegenwart, er nutzt viele Errungenschaften des modernen Romans, auch sein Erzähler spricht in zwei Perspektiven und reflektiert das auch gerne selbst:
Oh, ja. Ich weiß, Freund, hier geht es kreuz und quer: ich und er. Er Brandeis und ich Brandeis. Ich habe es sowieso probiert: »Ich« in die Gegenwart zu setzen, »Er« in die Vergangenheit. Ganz logisch. Logisch: und doch ging es dann gleich wieder durcheinander, obwohl ich weiß: Ordnung muß sein, wie bei den Fußnoten, was die Deutschen so gut können und die Franzosen nie lernen, nicht lernen wollen. Also gut. (97)
Überhaupt ist der ganze Roman erstaunlich selbstbewusst und reflektierend. Und Jaeggi gelingt es ausgesprochen gut, die Vielfalt der formalen Gestaltungselemente zu nutzen und recht harmonisch miteinander zu verbinden (auch wenn sich an einigen Stellen vielleicht manche Länge eingeschlichten hat).
Das so ein großartiger Text nicht zum Kanon deutschsprachiger Literatur gehört (selbst der Luchterhand-Verlag, bei dem seine Romane erschienen, kennt ihn nicht mehr …), ist eigentlich erstaunlich. Aber andererseits vielleicht auch symptomatisch: Längst nämlich scheint mir die Literatur zunehmend ihre eigene Geschichte (und damit auch ihre eigenen Voraussetzungen und (schon ganz banal handwerklichen) Errungenschaften) zu vergessen – es bleiben letztlich einfach nur ein paar wenige Texte und Autoren dauerhaft im kollektiven Gedächtnis. Stattdessen tut man – und das schließt sowohl die Produzentinnen als auch die Rezipienten (wie etwa die Literaturkritik) ein – gerne so, als würde jede Saison, spätestens aber jede Generation die Literatur neu erfunden. Die Lektüre von Texten wie dem Brandeis würde da mehr helfen als die “Wiederentdeckung” einst populärer Romane von von Fallada, Keun etc.
Die Geschichte tut nichts, sagt Brandeis, sie kämpft keine Kämpfe. Es ist der Mensch, der wirkliche, lebendige, Mensch, der alles tut, besitzt oder erkämpft. Es ist nicht die Geschichte, die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre Zwecke durchzuarbeiten, als ob sie eine aparte Person wäre; die Geschichte ist nichts als die Tätigkeit der ihre Zwecke verfolgenden Menschen. (21)
außerdem gelesen:
- Hans Jürgen von der Wense: documentaWanderungen. Herausgegeben & mit einem Nachwort von Harald Kimpel. Berlin: blauwerke 2015 (splitter 03). 74 Seiten.
- Risse #36
- SpritZ #218, mit zwei großartigen Erzählungen von Peter Schünemann

Schreibe einen Kommentar