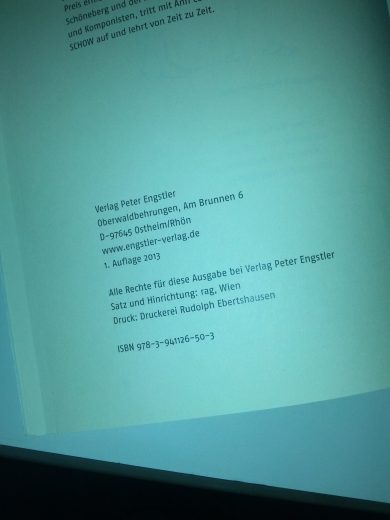Das vorzügliche Buch von Nils Minkmar ist — da darf man sich vom Untertitel nicht irreführen lassen — keine Reportage im eigentlich Sinne, und schon gar keine, die uns über Politik und Macht wirklich aufklärt. Minkmar ist nämlich zuallererst ein Meister der Wahrnehmung, Beschreibung und Deutung von (politischem) Handeln als symbolischen Handeln: Er kann Zeichen lesen — da ist er guter Kulturwissenschaftler. Und er kann es präzise (be-)schreiben. Dabei beschränkt er sich im Zirkus aber nicht auf den Zeichencharakter des von ihm beobachteten Wahlkampf von Peer Steinbrück und seinen Handlungen, sondern verbindet das mit politischer Erdung. So tauchen immer wieder die Fragen nach der tatsächlichen und medialen Macht der verschiedenen Akteure auf. Sehr gut gefallen hat mir, wie er seinen konkreten Gegenstand — Peer Steinbrück und seinen Wahlkampf — in größere Komplexe einbettet, etwa in Überlegungen zum Vertrauen in die/der Politik, zur psychologischen Situation der deutschen Bevölkerung 2013, zu Postdemokratie und den Medien.
Aber immer wieder ist auch Verzweiflung zu spüren: Verzweiflung, dass der Kandidat, der so richtig und gut ist, an so vielen eigentlich banalen und nebensächlichen Dingen scheitert, dass so vieles einfach nicht funktioniert (bei ihm selbst, im Apparat, in der SPD, in den Medien …). Das wird manchmal für meinen Geschmack etwas suggestiv. Deshalb fallen vor allem die gantz konkreten Analysen besonders positiv auf: Wie Minkmar das Wahlprogramm und vor allem den Slogan der SPD (“Das Wir entscheidet”) auseinandernimmt und deutet, das hat große Klasse.
Immer wieder treibt ihn bei seiner Beobachtung des Wahlkampfs vor allem das Verhältnis von Kandidat und Partei um: Steinbrück schildert er als klugen, sachlich und nuanciert denkenden und argumentierenden Überzeugungstäter, die Partei vor allem als unfähig, chaotisch und unwillig. Unwilligkeit kommt beim Kandidaten in Minkmars Beschreibung vor allem in einem Punkt auf: In der Weigerung, die Medienmaschine bzw. ihr System wirklich zu bedienen und zu benutzen — was im Verein mit der unfähigen PR der Partei zu den entsprechenden Katastrophen führt.
Aber dann ist das Buch für sich auch ein bisschen hilflos: Das ganze ist, wenn man es so beschreibt, halt ein Zirkus, da kann man nichts machen. Und wenn man, wie Steinbrück, nach eigenen Regeln zu spielen versucht oder auf seinen bewährten Standards beharrt, scheitert man eben und verliert …
Ein kleines Erinnerungsbuch an den 2011 verstorbenen Schlenker mit zwei Zyklen seiner Gedichte. Auffällig ist bei diesen schnell ihre suggestive Sprach-/Versmelodie mit den kurzen Versen. Die Sprache wird hier prägnant durch Glasklarheit und efährt dadurch auch eine gewisse Härte. Immer wieder greift Schlenker auf kurze Paarverse zurück: Knappheit und Dichte, starke Konzentration auf Zustände und Ergebnisse sind vielleicht wesentliche Merkmale seiner Lyrik. Nicht so sehr interessieren ihn dagegen Prozesse und Abläufe: Verben sind deshalb gar nicht so bedeutsam in diesen Texte:
genauigkeit
als gäbe es
keine grenzen (sankt nun, 49)
Schlenkers Lyrik, die hier immer wieder um das Problem der Freiheit kreist (“gut wäre auch freier wille” (15)), entwickelt dabei so etwas wie eine Topographie des Denkens mit Orten der Reflektion und der Selbstvergewisserung. Wege, Pfade etc. spielen hier eine besondere Rolle. Vor allem aber schafft sie es, durch ihre pointierten Erkenntnisse dabei sehr “schlau” zu wirken:
die zeit ist nun linear
wie ein fadenkreuzich weiß du bist da
bevor ich glaube wer ich bin. (4)
Deutlich wird das auch in dem wunderbaren “Lichtung” (8), für mich wohl das beste dieser Gedichte:
als ich einige glaubenssätze
zum ersten mal
laut nachsprechen konnte
hörte ich den donner
in der leitung
legte auf
und wählte neu
Ein befremdliches und erheiterndes Buch: Monika Rinck treibt sich schreibend und zeichnend in einer Phantasiewelt herum, in der Hasenhass ein geweisse Rolle spielt, in der Haydn zwischen Disko-Kugel und Scheibenqualle diskutiert wird und ähnlich Ungeheuerlichkeiten geheuer sind. Das sind kurze Versuche in & mit Sprach- und Denkbewegungen, dazu noch skurile Zeichnungen in und um die Witze herum — vielleicht kann man das auch als dozierende Sprachspiele lesen, die assoziativ verkettet und mäandernd über das Nichts, die Leere und andere Abwesenheiten nachdenken (“unschöne Überlegungen zur Praxis des Nichtens” (9)) und als eine “Reform der Seelengrammatik” (14) erheitern. “Die Dinge verwandeln sich, die Beziehungen bleiben bestehen.” (37) heißt es im kurzen “Nachtrag”. Und so verwandeln sich auch Text und Zeichnung, Wort und Bild in dieser Fibel:
Der Wind der Apokalypse weht durch das kaputte Gedächtnis. Und wieder treffen wir auf ein Verhältnis von taumelnder Äquivalenz. (7)
Der gemeinste Witz versteckt sich übrigens auf der letzten Seite, im Impressum — und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein Witz sein soll oder nur ein banaler Fehler ist — nach der Lektüre solcher Texte sucht (und findet) man eben überall Sinn ;-):