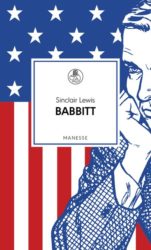Borsten und räuberisch sind meine spezialen
Steffen Popp, 118, 65
Verstärker auf Waldpfaden, Käfer spiegelns
Hase-Fuchs-Reh, selbstrufend Herr und Frau
Kuckuck. Der Mensch, idealisch, sei immer
dem Walde zu, singend. Beeren‑, Pilzkörbe
neben sich an dem glucksenden Bache sitzen
gleichsam zaubrisch. Nicht achte Zwergen-
werk niedrig und ‑horte in Germaniens Adern.
Nebst Dispo, Glatzen, Spuk, mag sein, auch
ächtes Gold … Denn wer hat nachgeforscht.
Waldwege
Kategorie: literatur Seite 2 von 37
Krieg
Alle Straßen sind mit Blut beglitzt.
Gierig lecken vieler Hunde Münder.
Bajonette lüstern hochgespitzt.
Witternd recken sich die Zwanzigpfünder.In den Nächten drohte der Komet.
Hermann Plagge (1914)
Über Städten platzen die Granaten.
Trommeln, Trommeln wird weitergeweht.
Braungeplättet liegen alle Saaten.
Wolke, wohin du gewolkt bist.
—aus: Elke Erb, “Ursprüngliche Akkumulation” (in: Elke Erb, Mensch sein, nicht, 1998)
Ein herrlicher Maitag – mir im Gemüte.

 Eine Rezension in der Süddeutschen Zeitung hat mich auf dieses schöne und spannende Fotobuch aufmerksam gemacht. Die Geschichte der Fotografie ist ja nun nicht gerade ein Gebiet, mit dem ich mich auskenne oder überhaupt irgendwie beschäftigt habe. Trotzdem (oder deshalb) macht das Buch viel Spaß. Dazu trägt auch nicht unerheblich die sehr informative (und selbst schon reich bebilderte) Einführung von Alfred Büllesbach bei, die es schafft, auch Laien der Fotografiegeschichte wie mir die Zusammenhänge, in den Baumann in den 20er und 30er Jahrend (und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg) arbeitete, aufzuzeigen. Dazu gehört nicht nur die wirtschaftliche SItuation freier Fotografen, sondern auch die Verbindung der Fotografie mit den Bergen, die zunehmende, zu dieser Zeit ja gerade in Schwung kommende touristische Erschließung der Alpen (durch den Bau von entsprechender Infrastruktur, durch den Urlaubsanspruch der Angestellten und natürlich auch durch die ökonomischen Möglichkeiten breiterer Bevölkerungsschichten, entsprechende Fahrten und Urlaube zu unternehmen), die als Hintergrund für Baumanns Fotos unabdingbar sind. Auch gefallen hat mir, die Betonung der Relevanz der Bergfilme für die Zeit — nicht nur für das Bild der Berge in der Bevölkerung, sondern auch als wirtschaftliches Standbein für nicht wenige Beteiligte
Eine Rezension in der Süddeutschen Zeitung hat mich auf dieses schöne und spannende Fotobuch aufmerksam gemacht. Die Geschichte der Fotografie ist ja nun nicht gerade ein Gebiet, mit dem ich mich auskenne oder überhaupt irgendwie beschäftigt habe. Trotzdem (oder deshalb) macht das Buch viel Spaß. Dazu trägt auch nicht unerheblich die sehr informative (und selbst schon reich bebilderte) Einführung von Alfred Büllesbach bei, die es schafft, auch Laien der Fotografiegeschichte wie mir die Zusammenhänge, in den Baumann in den 20er und 30er Jahrend (und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg) arbeitete, aufzuzeigen. Dazu gehört nicht nur die wirtschaftliche SItuation freier Fotografen, sondern auch die Verbindung der Fotografie mit den Bergen, die zunehmende, zu dieser Zeit ja gerade in Schwung kommende touristische Erschließung der Alpen (durch den Bau von entsprechender Infrastruktur, durch den Urlaubsanspruch der Angestellten und natürlich auch durch die ökonomischen Möglichkeiten breiterer Bevölkerungsschichten, entsprechende Fahrten und Urlaube zu unternehmen), die als Hintergrund für Baumanns Fotos unabdingbar sind. Auch gefallen hat mir, die Betonung der Relevanz der Bergfilme für die Zeit — nicht nur für das Bild der Berge in der Bevölkerung, sondern auch als wirtschaftliches Standbein für nicht wenige Beteiligte
Die Fotos selbst scheinen mir dann durchaus einen eigenen Blick von Baumann zu verraten (mit dem bereits erwähnten caveat, dass ich da über wenig Hintergrund verfüge): Ganz eigen, vor allem vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Extrem-Vermarktung der Berge als spektakulärster Spielplatz der Welt, ist die stille Ruhe und Gelassenheit der Schönheit der Berge (und auch ihrer Besucher, möchte ich sage, Besteiger oder Bezwinger wäre für die hier abgebildeten Menschen und ihre Haltung wohl der falsche Ausdruck, viel zu entspannt und zurückhaltend-freudige treten sie mir vors Auge).
Gerade im Vergleich zu heutigen bildlichen Darstellung von Bergen und den Menschen auf ihnen sieht das hier zahm aus. Auch, weil das eigentliche Erschließen der und das Bewegen in den Bergen eher ein Randthema bleibt. Und weil es vergleichsweise harmlose Gipfel der Alpen sidn — aber, und das ist eben der Witz, dennoch unvergesslich in Szene gesetzt. Wahrscheinlich spielt auch die Schwarz-Weiß-Fotografie eine Rolle, wohl gerade bei den auftauchenden Personenen, die dadurch eine andere Schärfe und Konturierung zu haben scheinen als in den späteren Farbfotografien (so ist zumindest mein eigener Eindruck …).
 Neuhäuser betrachtet Reichtum und damit zusammenhängende Tugenden und Probleme wie Gier, Gerechtigkeit, und Neid — der Titel ist hier tatsächlich sehr genau. Er argumentiert dabei vor allem moralphilosophisch. Ökonomische, politische und/oder soziale Kriterien spielen nur am Rand eine Rolle. Und dennoch ist das natürlich — das bleibt bei dem Thema und auch bei seinem Zugang gar nicht aus — natürlich ein politisches Buch, dass vor allem Superreiche für ihn unter moralischen, philosophischen und gesellschaftlichen (und damit ja auch politischen) Aspekten durchaus kritisch zu betrachen sind. Dabei geht es ihm aber überhaupt nicht um die Personen, sondern um die sich an ihnen manifestierenden Reichtümer — und damit auch die Unterschiede, die Grenzen. Und das hängt eben oft mit Ungerechtigkeiten zusammen. Eines seiner Kernargumente ist, dass Superreichtum — im Gegensatz zu Wohlstand und Reichtum — nicht (mehr) verdient sein kann und damit moralphilosophisch ein Problem ist.
Neuhäuser betrachtet Reichtum und damit zusammenhängende Tugenden und Probleme wie Gier, Gerechtigkeit, und Neid — der Titel ist hier tatsächlich sehr genau. Er argumentiert dabei vor allem moralphilosophisch. Ökonomische, politische und/oder soziale Kriterien spielen nur am Rand eine Rolle. Und dennoch ist das natürlich — das bleibt bei dem Thema und auch bei seinem Zugang gar nicht aus — natürlich ein politisches Buch, dass vor allem Superreiche für ihn unter moralischen, philosophischen und gesellschaftlichen (und damit ja auch politischen) Aspekten durchaus kritisch zu betrachen sind. Dabei geht es ihm aber überhaupt nicht um die Personen, sondern um die sich an ihnen manifestierenden Reichtümer — und damit auch die Unterschiede, die Grenzen. Und das hängt eben oft mit Ungerechtigkeiten zusammen. Eines seiner Kernargumente ist, dass Superreichtum — im Gegensatz zu Wohlstand und Reichtum — nicht (mehr) verdient sein kann und damit moralphilosophisch ein Problem ist.
Ein bisschen schade ist, dass Neuhäuser dabei oft nicht sehr in die Tiefe geht: Das ist manchmal etwas plaudernd geraten — was nicht heißt, dass Neuhäuser mit seiner Argumentation falsch läge. Aber manches scheint mir nicht zu ende gedacht/geschrieben, zumindest in diesem Büchlein (es ist ja nun nicht die einzige Auseinandersetzung des Autors mit diesem Thema).
 Kuhligk habe ich bisher eher am Rande wahrgenommen: Durchaus offenbar ansprechende Qualitäten im literarischen Schreiben, aber nicht mein dringenster Lektürewunsch. Die Sprache von Gibraltar könnte das ändern. Das ist nämlich ein feines Buch.
Kuhligk habe ich bisher eher am Rande wahrgenommen: Durchaus offenbar ansprechende Qualitäten im literarischen Schreiben, aber nicht mein dringenster Lektürewunsch. Die Sprache von Gibraltar könnte das ändern. Das ist nämlich ein feines Buch.
Ganz besonders der erste Teil, der titelgebende Zyklus über Gibraltar und die europäische Enklave dort, ist richtig gut. Das ist keine übermäßige Betroffenheitsliteratur, der man die Bemühtheit an jedem Wort anmerkt. Aber es ist ein genaues Hinschauen (was an sich schon durchaus eine lohnenswerte Leistung wäre). Und es ist vor allem die Fähigkeit, aus dem Hinschauen, aus der Absurdität und auch der Grausamkeit der Welt in diesem kleinen Ort eine poetische Sprache zu finden und zu bilden. Damit lässt Kuhligk auch immer wieder die zwei Welten aufeinander prallen und sich nicht nur heftig aneinander reiben, sondern krachend miteinander Verhaken.
Sehr passend scheint mir auch das (sonst bei Kuhligk meines Wissens nicht vorherrschend, sogar sehr selten eingesetzte) Mittel der langen, erschöpfenden, ermüdenden Reihung in diesem Zyklus eingesetzt zu wein — etwa die sehr eindrücklich wirkende und genaue Litanei “wenn man …”.
Und dann gibt es auch noch in den restlichen Abschnitten, in der zweiten Hälfte des Bandes, gute und schöne Gedichte, die etwa sehr gelungen die Trostlosigkeit des Landlebens im “Dorfkrug” (47) einfangen oder in der Dopplung von “Was wir haben” (50) und “Was fehlt” (51) beinahe so etwas wie eine unsentimentale Landschaftslyrik entwickeln.
wenn man das Wort „Kapitalismus“ ausspricht, ist im Mund viel los / wenn man Kohle hochträgt, trägt man Asche runter (35)
 Nun ja. Das war eine eher enttäuschende Lektüre. Kaube beobachtet das Bildungssystem im weiteren Sinne schon länger und hat sich auch immer wieder darüber geäußert, durchaus auch jenseits der taesaktuellen Anlässe. Seine kleine Schrift Im Reformhaus habe ich damals durchaus mit Gewinn gelesen. Bei Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? ist das aber leider anders. Der Titel hätte ja schon eine Warnung sein können. Schon die ersten Seiten und die anfänglichen Kapitel zeigen schnell ein Hauptmanko des Buches: viel Gerede, viel schöne Beispiele, aber eher wenig Substanz.
Nun ja. Das war eine eher enttäuschende Lektüre. Kaube beobachtet das Bildungssystem im weiteren Sinne schon länger und hat sich auch immer wieder darüber geäußert, durchaus auch jenseits der taesaktuellen Anlässe. Seine kleine Schrift Im Reformhaus habe ich damals durchaus mit Gewinn gelesen. Bei Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? ist das aber leider anders. Der Titel hätte ja schon eine Warnung sein können. Schon die ersten Seiten und die anfänglichen Kapitel zeigen schnell ein Hauptmanko des Buches: viel Gerede, viel schöne Beispiele, aber eher wenig Substanz.
Vor allem hat mich sehr schnell und recht nachhaltig genervt, wie selektiv er liest/wahrnimmt und dann leider auch argumentiert. Das wird zum Beispiel in Bezug auf Bildungsempiriker (für ihn ja fast ein Schimpfwort) sehr deutlich, aber auch in seinen ausgwählten Bezügen auf Bildungsungleichheit und Chancenungleichheit im Bildungsbereich. Das ist ja eines seiner Hauptargumente hier: Dass die Schule nicht dafür da ist, Ungleichheit zu beseitigen, dass sie von Politiker*innen zunehmend dazu “benutzt” wird, soziale Probleme zu lösen. Ich kann ihm ja durchaus darin (cum grano salis) zustimmen, dass die Schule das kaum leisten kann. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich ein so bestimmendes Motiv der Bildungspolitik und so sehr ein wirkliches Problem ist. Jedenfalls haben diese Nachlässigkeiten mir es dann ausgesprochen schwer gemacht, die positiven Aspekte wirklich zu würdigen (die aber durchaus vorhanden sind, nur leider eben etwas begraben unter dem einseitigen, schimpfenden Gewetter Kaubes).
außerdem gelesen:
- Lütfiye Güzel: sans trophée. Duisburg, Berlin: go-güzel-publishing 2019.
- Siegfried Völlger: (so viel zeit hat niemand). Gedichte. München: Allitera 2018 (Lyrikedition 2000). 105 Seiten. ISBN 978–3‑96233–075‑0.
- Philipp Hübl: Bullshit-Resistenz. 2. Auflage. Berlin: Nicolai 2019 (Tugenden für das 21. Jahrhundert). 109 154 Seiten. ISBN 978–3‑96476–009‑8.

 Als Biographie ist das für mich kaum satisfaktionsfähig: Zu blass und verschwommen bleibt das Bild. Der Mensch Bismarck, die Person, tritt nahezu gar nicht auf — ab und an gibt es Hinweise auf seine Gesundheit oder ein paar ganz wenige auf Frau und Kinder. Im Vordergrund oder besser alleine im Fokus steht sein politisches Handeln. Das beschreibt Kolb mit Zuneigung, aber durchaus auch mit Blick für die Ambivalenzen Bismarcks. Aber auch das Zentrum, die Politik, bleibt blut- und farblos. Das liegt vor allem daran, dass Kolb oft sehr großzügig durch die Geschehnisse und Taten durch eilt udn nur die Ergebnisse berichtet, den Weg aber meist nur summarisch (und oft genug mit dem Hinweis: Die Details sind bekannt). Das wiederum hängt damit zusammen, dass er keinen rechten Zugriff findet: Eigentlich ist das eine preußische/deutsche Geschichte am Beispiel Bismarcks. Und beides ist in diesem Umfang natürlich kaum besonders intensiv oder tiefgehend zu leisten.
Als Biographie ist das für mich kaum satisfaktionsfähig: Zu blass und verschwommen bleibt das Bild. Der Mensch Bismarck, die Person, tritt nahezu gar nicht auf — ab und an gibt es Hinweise auf seine Gesundheit oder ein paar ganz wenige auf Frau und Kinder. Im Vordergrund oder besser alleine im Fokus steht sein politisches Handeln. Das beschreibt Kolb mit Zuneigung, aber durchaus auch mit Blick für die Ambivalenzen Bismarcks. Aber auch das Zentrum, die Politik, bleibt blut- und farblos. Das liegt vor allem daran, dass Kolb oft sehr großzügig durch die Geschehnisse und Taten durch eilt udn nur die Ergebnisse berichtet, den Weg aber meist nur summarisch (und oft genug mit dem Hinweis: Die Details sind bekannt). Das wiederum hängt damit zusammen, dass er keinen rechten Zugriff findet: Eigentlich ist das eine preußische/deutsche Geschichte am Beispiel Bismarcks. Und beides ist in diesem Umfang natürlich kaum besonders intensiv oder tiefgehend zu leisten.
 Manituana reicht leider nicht an die letzten Bände von Wu Ming heran. Das kann durchaus daran liegen, dass der USA, ihre Unabhängigkeitskrieg und der Kampf mit, um und gegen die “Indianer” schon an sich nicht so ganz mein Ding sind. Da passiert dann zwar wieder viel, es wird gekämpft, betrogen, verraten und verhandelt, eine Delegation darf auch nach England reisen und sich im Luxus (und den Niederungen Londons) des Adelslebens gehörig fremd fühlen. Ich hatte beim Lesen aber schon eigentlich durchweg den Eindruck, dass das an Spannung und vor allem hinsichtlich des bildhaften, detailreichen Erzählens einfach nicht (mehr) so gut ist. Zu sehr dringt hier immer wieder die Absicht an die Oberfläche und stellt sich vor den Text — und damit funktioniert genau das, was bei anderen Texten von Wu Ming die besondere Spannung und den speziellen Reiz ausmacht, hier leider nicht.
Manituana reicht leider nicht an die letzten Bände von Wu Ming heran. Das kann durchaus daran liegen, dass der USA, ihre Unabhängigkeitskrieg und der Kampf mit, um und gegen die “Indianer” schon an sich nicht so ganz mein Ding sind. Da passiert dann zwar wieder viel, es wird gekämpft, betrogen, verraten und verhandelt, eine Delegation darf auch nach England reisen und sich im Luxus (und den Niederungen Londons) des Adelslebens gehörig fremd fühlen. Ich hatte beim Lesen aber schon eigentlich durchweg den Eindruck, dass das an Spannung und vor allem hinsichtlich des bildhaften, detailreichen Erzählens einfach nicht (mehr) so gut ist. Zu sehr dringt hier immer wieder die Absicht an die Oberfläche und stellt sich vor den Text — und damit funktioniert genau das, was bei anderen Texten von Wu Ming die besondere Spannung und den speziellen Reiz ausmacht, hier leider nicht.
 Das ist ein überraschend feines, kleines Buch. Jan Peter Bremer hatte ich bisher ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber in Der junge Doktorand zeigt er sich durchaus als gewiefter Erzähler, der sein Handwerk versteht und vor allem ernst nimmt: Ernst nehmen in dem Sinn, dass er sich bemüht, sauber zu arbeiten, Fehler zu vermeiden. Das zeigt der Text, der mit Gespür und Formbewusstsein erzählt ist. Das kunstvolle Beherrschen des Erzählens zeigt sich auch in dem Umfang des Buches: Das ist ein kleiner Roman. Es geht auch gar nicht so sehr um große, allumfassende Dinge — die Welt wird hier nicht gerade erzählt. Aber auch wenn er sich bescheiden gibt: Bremer gelingt es doch, auf den wenigen Seiten mit genauen Sätzen, treffenden Beschreibungen und Bewusstsein für das richtige Tempo große Themen zu erzählen: Es geht um Ehe, um Gesellschaft und Individuum, und natürlich, vor allem, um Kunst — und auch ein bisschen um nicht-normierte Lebensläufe wie den des jungen Doktoranden, der weder jung noch Doktorand ist. Das klingt in der Zusammenfassung recht trocken und ja, fast banal, entfaltet bei Bremer aber eine treffenden und subtile Komik. Und das macht dann einfach Spaß.
Das ist ein überraschend feines, kleines Buch. Jan Peter Bremer hatte ich bisher ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber in Der junge Doktorand zeigt er sich durchaus als gewiefter Erzähler, der sein Handwerk versteht und vor allem ernst nimmt: Ernst nehmen in dem Sinn, dass er sich bemüht, sauber zu arbeiten, Fehler zu vermeiden. Das zeigt der Text, der mit Gespür und Formbewusstsein erzählt ist. Das kunstvolle Beherrschen des Erzählens zeigt sich auch in dem Umfang des Buches: Das ist ein kleiner Roman. Es geht auch gar nicht so sehr um große, allumfassende Dinge — die Welt wird hier nicht gerade erzählt. Aber auch wenn er sich bescheiden gibt: Bremer gelingt es doch, auf den wenigen Seiten mit genauen Sätzen, treffenden Beschreibungen und Bewusstsein für das richtige Tempo große Themen zu erzählen: Es geht um Ehe, um Gesellschaft und Individuum, und natürlich, vor allem, um Kunst — und auch ein bisschen um nicht-normierte Lebensläufe wie den des jungen Doktoranden, der weder jung noch Doktorand ist. Das klingt in der Zusammenfassung recht trocken und ja, fast banal, entfaltet bei Bremer aber eine treffenden und subtile Komik. Und das macht dann einfach Spaß.
 Die Winterbienen haben mich etwas enttäuscht und ratlos zurückgelassen. Ich habe Scheuer ja durchaus als erfahrenen Erzähler und Autor schätzen gelernt. Dieser Roman hat aber mehr Schwächen als er mit seinen eher mäigen Stärken ausgleichen kann. Da ist zum einen die seltsame Tagebuch-Fiktion. Die passt nämlich vorne und hinten nicht: Gut, dass der Tagebuchtext in Fußnoten die lateinischen Zitate übersetzt, das wird noch von der Herausgeberfiktion gedeckt. Dass (als ein Beispiel von vielen) Egidius Arimond (schon der Name macht mich ja beinahe wahnsinnig) als erfahrener Imker aber nach jahrzehntelanger Tätigkeit seinem Tagebuch erklärt, was er warum bei den Bienen, vor allem eben im Winter, macht, ist einfach handwerklicher bzw. erzähltechnischer Unsinn, der einer Lektorin durchaus mal hätte auffallen dürfen. Der Roman an sich ist für mich etwas zwiespältig: Natürlich sehr durchdrungen von völkischer Ideologie, die eben wieder durch die Tagebuch-Fiktion legitimiert wird. Dann ist da noch das Leiden eines Krieges, der auf die Aggressoren zurückgefallen wird, hier aber — in Arimond und den restlichen, schemenhaft auftauchenden Eifelbewohnern — eher als irgendwie gegeben hingenommen wird. Angeblich ist die erzählte Welt geprägt von dem “Wunsch nach einer friedlichen Zukunft” — davon merkt man im Text aber reichlich wenig. Im ganzen bleibt mir das etwas fragwürdig und vor allem ausgesprochen unbefriedigend: Warum erzählt Scheuer uns das? Und warum versteckt sich der Autor so (beinahe) vollkommen hinter seiner Figur — was will mir das eigentlich sagen?
Die Winterbienen haben mich etwas enttäuscht und ratlos zurückgelassen. Ich habe Scheuer ja durchaus als erfahrenen Erzähler und Autor schätzen gelernt. Dieser Roman hat aber mehr Schwächen als er mit seinen eher mäigen Stärken ausgleichen kann. Da ist zum einen die seltsame Tagebuch-Fiktion. Die passt nämlich vorne und hinten nicht: Gut, dass der Tagebuchtext in Fußnoten die lateinischen Zitate übersetzt, das wird noch von der Herausgeberfiktion gedeckt. Dass (als ein Beispiel von vielen) Egidius Arimond (schon der Name macht mich ja beinahe wahnsinnig) als erfahrener Imker aber nach jahrzehntelanger Tätigkeit seinem Tagebuch erklärt, was er warum bei den Bienen, vor allem eben im Winter, macht, ist einfach handwerklicher bzw. erzähltechnischer Unsinn, der einer Lektorin durchaus mal hätte auffallen dürfen. Der Roman an sich ist für mich etwas zwiespältig: Natürlich sehr durchdrungen von völkischer Ideologie, die eben wieder durch die Tagebuch-Fiktion legitimiert wird. Dann ist da noch das Leiden eines Krieges, der auf die Aggressoren zurückgefallen wird, hier aber — in Arimond und den restlichen, schemenhaft auftauchenden Eifelbewohnern — eher als irgendwie gegeben hingenommen wird. Angeblich ist die erzählte Welt geprägt von dem “Wunsch nach einer friedlichen Zukunft” — davon merkt man im Text aber reichlich wenig. Im ganzen bleibt mir das etwas fragwürdig und vor allem ausgesprochen unbefriedigend: Warum erzählt Scheuer uns das? Und warum versteckt sich der Autor so (beinahe) vollkommen hinter seiner Figur — was will mir das eigentlich sagen?
außerdem gelesen:
- Heimito von Doderer: Unter schwarzen Sternen. Erzählungen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1973. 154 Seiten. ISBN 3–7642-0055–3.
- Glenn Gould: Freiheit und Musik. Reden und Schriften. 2., durchgesehene und ergänzte Auflage. Ditzingen: Reclam 2019 (Was bedeutet das alles?). 84 Seiten. ISBN 978–3‑15–019412‑6.
- Algernon Blackwood: Eine Kanufahrt auf der Donau. / Die Weiden. Ulm: danube bookes 2018. 154 Seiten. ISBN 978–3‑946046–13‑4.
- Sibylle Schwarz: Ist Lieben Lust, wer bringt dann das Beschwer?. Leipzig: Reinecke & Voß 2016. 58 Seiten. ISBN 978–3‑942901–21‑5.
Hölderlin und die Bibel sind die einzigen Dinge auf der Welt, die sich niemals widersprechen können.
—Gershom Sholem, Tagebuch 1918–1919
Nichts ist so egal wie etwas, das neben Goethe und Schiller steht. Niemand besucht es. —Clemens J. Setz, Bot, 38
The past is fragile, as fragile as bones grown brittle with age, as fragile as ghosts seen in windows or the dreams that fall apart upon waking and leave nothing behind them but a feeling of unease or distress or, more rarely, a kind of eerie satisfaction.
—Siri Hustvedt, Memories of the Future, 13

 Schon der Untertitel zeigt die Ambivalenz des Buches: Ist das ein Journal oder sind es Geschichten? Man muss das wohl wirklich zusammendenken: Das ist kein Tagebuch, also schon Fiktion. Aber es simuliert das tägliche Schreiben: Der Erzähler nimmt sich ein Notizbuch mit 200 Seiten vor und beschreibt jeden Tag eine Seite mehr oder weniger voll. Vielleicht hat Becker das auch so gemacht — aber das ist ja auch egal. Schade ist nur, dass der Verlag die Idee, die 200 Seiten eines Journale fiktional zu beschreiben (des Erzählers), nicht im realen Buch abbilden wollte — das wäre doch eine schöne Performanz des Textes gewesen, der sein Organisationsprinzip ja immerhin selbst erläutert. Dafür sind die Journalgeschichten aber immerhin ohne Seitenzahlen gedruckt.
Schon der Untertitel zeigt die Ambivalenz des Buches: Ist das ein Journal oder sind es Geschichten? Man muss das wohl wirklich zusammendenken: Das ist kein Tagebuch, also schon Fiktion. Aber es simuliert das tägliche Schreiben: Der Erzähler nimmt sich ein Notizbuch mit 200 Seiten vor und beschreibt jeden Tag eine Seite mehr oder weniger voll. Vielleicht hat Becker das auch so gemacht — aber das ist ja auch egal. Schade ist nur, dass der Verlag die Idee, die 200 Seiten eines Journale fiktional zu beschreiben (des Erzählers), nicht im realen Buch abbilden wollte — das wäre doch eine schöne Performanz des Textes gewesen, der sein Organisationsprinzip ja immerhin selbst erläutert. Dafür sind die Journalgeschichten aber immerhin ohne Seitenzahlen gedruckt.
Man erlebt, seufzt der Mensch, das Wetter gar nicht mehr, wie es kommt, wie es ist, wie es geht. Man erlebt nur noch, wie es eine Prophezeiung erfüllt. (150)
Der Text ist eine Mischung aus grundsätzlichen Reflexionen, leicht und fast nebenbei, als Zufall und Fundstücke etc präsentiert, mit den Erinnerungen und vielfältigen Erinnerungsanlässen eines alt(ernd)en Mannes, die immer wieder vom Einbruch der “Realität” der Schreibgegenwart, zum Beispiel den wiederholt auftauchenden “Gästen”, unterbrochen werden. Vieles sind “nette”, freundliche, zugewandte Tagebuchskizzen mit viel untergemischter (persönlicher) “Vergangenheitsbewältigung”, auch viel Hitler & Co. Das ist dann — nicht nur hin und wieder — schon etwas sentimental, aber dank der Wortkunst Beckers noch auszuhalten. Dennoch ist mir das insgesamt etwas zu belanglos, das plätschert zu ziellos vor sich hin. Die sympathische kurze/kleine Form wird für meinen Geschmack nicht ausreichend für die poetische Verdichtung genutzt, deshalb wirkt vieles doch etwas blass und bleibt ohne tiefere Wirkung für mich.
In diesem Jahr könnte es soweit sein. Im vergangenen Jahr hätte es auch soweit sein können, ebenso im Jahr davor, oder vor zwei, drei, vor zehn Jahren schon. Vielleicht ist es erst im nächsten Jahr soweit, oder im übernächsten; dabei müssen es nicht einmal Jahre, es können auch kürzere Fristen sein, Wochen, Tage, Stunden, wer weiß. Ganz sicher ist, irgendwann ist es soweit, ob plötzlich, oder ob es sich hinzieht. (16)
Aber, und das ist halt ein großes Aber: Literarisch taugt das nicht, weder formal noch stilistisch trägt das irgendwie. Ästhetisch ist das belanglos (so wie der Inhalt der Geschichte ja auch eigentlich eher belanglos bleibt). Das funktioniert als nette — und recht flache — Unterhaltung, als eine unkomplizierte, anspruchslose Lektüre für zwischendurch, mit dem einen oder anderen Lacher. Die Süddeutsche hat das in ihrer Rezension als “Privatfernsehliteratur” bezeichnet (behauptet der Perlentaucher) — und das trifft es ziemlich genau: Mit und vor allem über die vermurksten Leben der anderen lachen, sich selbst dabei wohlig überheblich und sicher fühlen — viel mehr will und kann dieser Text nicht.
Ich weiß ja wieder einmal nicht so recht: Von der Kritik recht einhellig sehr positiv bewertet und besprochen, finde ich das Buch dann doch eher belanglos. Ja, die fünf Lebensläufe der Frauen, die lose miteinander verknüpft diesen Roman bzw. dessen fünf Abschnitte bilden, sind interessant zu verfolgen (auch gerade als männlicher Leser wahrscheinlich). Aber das bleibt im Erzählen wieder so schrecklich banal und gewöhnlich. Vielleicht sind solche Bücher, gerade in ihrer Stillosigkeit (oder zumindest in ihrem neutralen, unauffälligen Stil) notwendig — aber packen oder gar begeistern kann mich das nicht.
Das mag auch daran liegen, dass mir das arg pessimistisch grundiert zu sein scheint: Änderungen, Entwicklungen der Protagonistinnen zum Beispiel, scheinen hier kaum bis gar nicht möglich. Ansätze dazu gibt es, die werden aber gerne und immer wieder von der Außenwelt, von den anderen, von Männern und Kindern und anderen Verwandten vor allem, vernichtet und zerschmettert.
Sie weiß mehr als damals, doch was nützt es ihr? (125)
Interessant übrigens, das nur am Rande, dass alle Frauen auffällig viel Musik — und zwar in erster Linie klassische Musik — hören. Das wäre wahrscheinlich einen genaueren Blick wert. Beim ersten Lesen scheint mir das aber, gerade im Zusammenhang mit den erzählten Lebensläufen und deren Problemen, nicht besonders ergiebig. Aufgefallen ist es mir vor allem, weil es mir zumindest zu einem Teil der Figuren nicht so recht zu passen scheint. Aber typisch für Die Liebe im Ernstfall ist, dass auch dies — wie nahezu alle äußere Handlung (abseits von der Gefühlsinnenwelt der Protagonistinnen) nur Nebensache ist, nur so anbei geschieht. “Sätze ohne Spannung, ohne Klang, ohne Zauber” beschreibt eine der Protagonistinnen, die als Schriftstellerin arbeitet oder zu arbeiten versucht, wenn die Kinder ihr Zeit und Energie lassen, einmal ihre Tagesproduktion (125). Und das trifft auch Die Liebe im Ernstfall ziemlich genau.
außerdem gelesen:
- Moritz Föllmer: “Ein Leben wie im Traum”. Kultur im Dritten Reich. München Beck 2016. 288 Seiten. ISBN 978–3‑406–67905‑6.
- Jan Philipp Reemtsma: Gewalt als Lebensform. Zwei Reden. Stuttgart: Reclam 2016. 64 Seiten. ISBN 9783150193822.
- Heinz Gärtner: Der Kalte Krieg. Bündnisse — Krisen — Konflikte. Wiesbaden: marix 2017. 254 Seiten. ISBN 9783737410335.
- Hans Eisenträger: Der Mann seiner Frau. Novelle. Hrsg. von Nikola Roßbach. Hannover: Wehrhahn 2018. 68 Seiten. ISBN 978–3‑86525–641‑6.
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten;
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:
Denn was innen ist das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis
—
Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernsten Spieles:
Kein Lebendiges ist ein Eins,
Immer ist’s ein Vieles.Johann Wolfgang von Goethe, Epirrhema (aus: Sammlung von 1827, Abschnitt “Gott und Welt”)