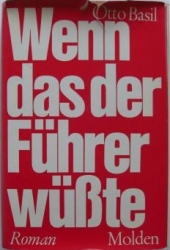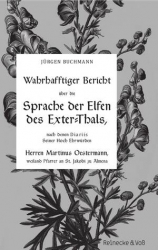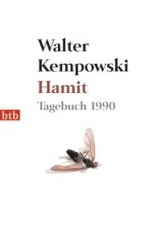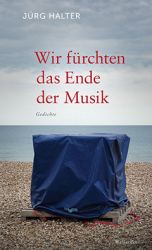immer stärkere lesergehirne bedrohen die wirkkraft der dichtung.—Ulf Stolterfoht, fachsprachen XXIV, dogma für dichtung, 2005
Schlagwort: ulf stolterfoht

Ins Netz gegangen am 2.11.:
- Jens Balzer zu Musikvideos: Youtube kills the Youtube-Star Justin Bieber | Berliner Zeitung → jens balzer über den aktuellen zusammenhang von pop, stars, youtube, konzerten und fans
Der Versuch, als real musizierender Mensch auf einer Bühne wenigstens kurz zu reinkarnieren, scheitert an der Indifferenz eines Publikums, dem es reicht, in virtuellen Räumen und bei sich selber zu sein. Der erste Star der Youtube-Epoche wird als deren tragischer Held von der Bühne gekreischt.
- Was a server registered to the Trump Organization communicating with Russia’s Alfa Bank? | slate → eine total verrückte geschichte: trump hat(te) einen server, der (fast) nur mit einem server der russischen alfa-bank kommunizierte. und keiner weiß, wieso, was, warum — beide seiten behaupten, das könne nicht sein …
What the scientists amassed wasn’t a smoking gun. It’s a suggestive body of evidence that doesn’t absolutely preclude alternative explanations. But this evidence arrives in the broader context of the campaign and everything else that has come to light: The efforts of Donald Trump’s former campaign manager to bring Ukraine into Vladimir Putin’s orbit; the other Trump adviser whose communications with senior Russian officials have worried intelligence officials; the Russian hacking of the DNC and John Podesta’s email.
(und nebenbei ganz interessant: dass es spezialisten gibt, die zugriff auf solche logs haben …)
- The Digital Transition: How the Presidential Transition Works in the Social Media Age | whitehouse.gov → die pläne der übergabe der digitalen massenkommunikation (und accounts) des us-präsidenten. interessant: dass die inhalte zwar erhalten bleiben, aber als archiv unter neuen account-namen. und die “offiziellen” accounts geleert übergeben werden.
- Reformationsjubiläum: Lasst uns froh und Luther sein | FAZ → sehr seltsamer text von jürgen kaube. am reformationsjubiläum gäbe es einiges zu kritiseren. aber das ist der falsche weg — zum einen ist die evangelische kirche deutschlands keine luther-kirche (und käßmann sicher nicht ihre wesentlichste theologin). zum anderen scheint mir kaubes kritikpunkt vor allem zu sein, dass evangelische theologie sich in den 500 jahren gewandelt hat und nicht gleichermaßen konservativ-fundamentalistisch-autoritär ist wie bei luther selbst. was soll das aber?
- Siri Hustvedt und Paul Auster | Das Magazin → langes gespräch mit hustvedt und auster, dass sich aber nahezu ausschließlich um die politische lage dreht — immerhin eine halbe frage gilt auch dem, was sie tun — nämlich schreiben
- Das Paradox der Demokratie: Judith Butler über Hillary Clinton | FAZ → langes, gutes interview mit judith butler über demokratie, versammlungen, freiheiten, körper und identitäten
- Aids in Amerika: HIV kam um 1970 in New York an | Tagesspiegel → forscher haben mit genetischen analysen von blutkonserven die geschichte von aids in den usa neu geschrieben — nicht patient O war der erste, der virus kam schon jahre vorher nach new york. spannend, was heute so alles geht …
- Frankfurter Buchmesse „Schwierige Lyrik zu einem sehr hohen Preis“ | Berliner Zeitung → mal wieder ein interview mit ulf stolterfoht zum funktionieren von brueterich press. dem verlag würde es wahrscheinlich mehr helfen, wenn seine bücher besprochen würden und nicht nur der verlag ;-) …
Ich verdiene nicht nur mit dem Schreiben kein Geld, ich verdiene auch mit dem Übersetzen kein Geld. Da möchte man dann mit dem Verlegen natürlich auch nichts verdienen. Das berühmte dritte unrentable Standbein. Das Paradoxe an der Sache ist nun aber, dass ich trotzdem irgendwie davon leben kann, und das schon ziemlich lange. Diese ganzen nicht oder schlecht bezahlten Tätigkeiten haben, zumindest in meinem Fall, dazu geführt, dass eine indirekte Form der Vergütung stattfindet, also etwa in Form von Preisen, Stipendien, Lehrtätigkeiten, Lesungen und Moderationen. Und ich glaube, dass durch die Verlegerei das Spielfeld noch ein bisschen größer geworden ist. Das hat jedoch bei der Gründung des Verlags keine Rolle gespielt. Den Verlag gibt es, weil ich das schon sehr lange machen wollte. Schreiben tue ich ja auch, weil ich das schon immer wollte. Das reicht mir völlig aus als Begründung. Mehr braucht es nicht.
- “Die Ökonomisierung der Natur ist ein Fehler” | der Freitag → barbara unmüßig, im vorstand der heinrich-böll-stiftung, über “grüne ökonomie”, notwendige umdenkprozesse und warum kompensation nicht reicht
Wir bräuchten vielmehr Mittel für den ökologischen Landbau oder um herauszufinden, wie eine wachstumsbefriedete Gesellschaft und Wirtschaft aussehen kann. Es liegt eindeutig zu viel Gewicht auf technologischen denn auf sozialen und kulturellen Veränderungen.
…
Das ist der wohl größte Fehler der Grünen Ökonomie: Dinge, die nie ökonomisiert waren, zu messen, zu berechnen, zu ökonomisieren. Die Monetarisierung der Natur.
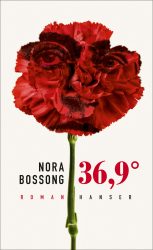 Das ist in meinen Augen ein sehr schwacher Roman, der mich sehr enttäuscht hat. Schon Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat mich zwar auch nicht großartig begeistert, war aber doch deutlich besser, was etwa die Konstruktion und die stilistische Ausarbeitung angeht — beide Romane bestärken eigentlich nur meinen Wunsch, von Bossong (wieder) mehr Lyrik zu lesen …
Das ist in meinen Augen ein sehr schwacher Roman, der mich sehr enttäuscht hat. Schon Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat mich zwar auch nicht großartig begeistert, war aber doch deutlich besser, was etwa die Konstruktion und die stilistische Ausarbeitung angeht — beide Romane bestärken eigentlich nur meinen Wunsch, von Bossong (wieder) mehr Lyrik zu lesen …
Der Text von 36,9° wirkt merkwürdig müde und erschöpft. Vielleicht ist das ja eine beabsichtigte Parallele von Inhalt und Form (schließlich geht es um das aufzehrende, schwierige, harte Leben des Antonio Gramcsi), aber mich hat das trotzdem aus Gründen, die ich nicht so genau benennen kann, eher abgestoßen. Erzählt wird in zwei Perspektiven in zwei (groben) Zeitebenen das Leben Gramcsis und eine Art Forschungsaufenthalt des Gramcsi-Spezialisten Anton Stöver, der in Rom nach einem verschollenen Manuskript sucht. Wieso es diese Doppelung von Erzähler und Zeiten eigentlich gibt, ist mir nicht so ganz klar geworden — nur um die Überzeitlichkeit zu betonen? Um nicht in den Verdacht zu geraten, eine Gramcsi-Biographie zu schreiben? Und wozu ist dann der Manskript-Krimi (der ja als solcher überhaupt nicht funktioniert, weil er nicht richtig erzählt wird, sondern nur als Hilfsmittel dient und ab und an hervorgeholt wird …) gut? Oder sollen die Zeitebenen nur signalisieren, dass dies kein „normaler“ historischer Roman ist? (Der in den Gramsci-Kapiteln als solcher auch eher schlecht funktioniert, aber das ja wiederum auch gar nicht sein will …)
Zur Politik bleibt der Text dabei merkwürdig distanziert, die Leidenschaft etwa Gramcsi (im wahrsten Sinne, nämlich mit all den Leiden) wird vor allem behauptet, aber nicht eigentlich erzählt. Und das private fühlt sich oft aufdringlich, etwas schmierig an (wie Boulevardjournalismus). Das erschien mir oft als eine Art ungewollte Nähe, ein intimes Stochern, von deren Notwendigkeit die Erzähler selbst nicht so ganz überzeugt schienen. Zumal Stöver ist ja auch ein ausgesprochener Unsympath — und auch Gramcsi bleibt eine seltsame Figur. Beide Charaktere sind dabei seltsam rücksichtslos gegen sich selbst und ihr privates Umfeld. Und gerade das, was ja der Kern des Romans zu sein scheint, bleibt extrem blass, kaum motiviert — weil die Ideen, die diese Rücksichtslosigkeit erfordern, höchstens angerissen werden.
Wenn die Verlagswerbung das Ziel des Buches richtig beschreibt: „Nora Bossong erzählt vom Konflikt zwischen den großen Gefühlen und dem Kampf für die ganze Menschheit“, dann funktioniert 36,9° überhaupt nicht. Und das liegt unter anderem eben daran, dass der “Kampf für die ganze Menschheit”, die Weltverbesserung eigentlich gar nicht vorkommt, der Text bleibt viel zu sehr im individuellen, biographischen Klein-klein stecken. Dazu kommt dann noch eine für mich unklare Struktur — die Reihenfolge der Kapitel mit den Vor- und Rückblenden sowie die Erzählerwechsel erschließen sich mir einfach nicht. Ab und an funkelt mal ein schöner Satz, ein gelungener Abschnitt. Aber der Rest ist ein grau zerfließend Textbrei, der mich weder faszinieren noch überzeugen kann.
[…] ich wollte die Dinger nicht mehr bis zum Grund durchschauen, denn was lag dort? Nur Steine und Kiesel, nur Fußnoten und Quellenangaben. (25)
 Der Titel der Münchner Rede zur Poesie von Ulf Stolterfoht, dem Autor so vorzüglicher Zyklen wie den Fachsprachen und jetzt Verleger der Brueterich-Press (der selbst viel zu wenig veröffentlicht …) sagt eigentlich schon alles: „Über Musik, Euphorie und schwierige Gedichte“ spricht er. Stolterfoht, der sich als „Experte für Euphorie“ (7) vorstellt und „Ahnung“ von „der“ Lyrik erst einmal kategorisch verneint, führt anhand einer reihe Gedichte exemplarisch vor, was Lyrik ist und kann, was Sprache im Gedicht ausmacht und natürlich auch, was „schwierige Lyrik“ (heutzutage ja fast ein Pejorativum) eigentlich ist. Und er betont, dass das „Nicht-verstehen-müssen“ dieser Gedichte eine großartige Erfahrung ist — für Leser und Schreiber. Für beide Seiten ist das eine Befreiung, die einen unerschöpflichen Reigen an Möglichkeiten eröffnet.
Der Titel der Münchner Rede zur Poesie von Ulf Stolterfoht, dem Autor so vorzüglicher Zyklen wie den Fachsprachen und jetzt Verleger der Brueterich-Press (der selbst viel zu wenig veröffentlicht …) sagt eigentlich schon alles: „Über Musik, Euphorie und schwierige Gedichte“ spricht er. Stolterfoht, der sich als „Experte für Euphorie“ (7) vorstellt und „Ahnung“ von „der“ Lyrik erst einmal kategorisch verneint, führt anhand einer reihe Gedichte exemplarisch vor, was Lyrik ist und kann, was Sprache im Gedicht ausmacht und natürlich auch, was „schwierige Lyrik“ (heutzutage ja fast ein Pejorativum) eigentlich ist. Und er betont, dass das „Nicht-verstehen-müssen“ dieser Gedichte eine großartige Erfahrung ist — für Leser und Schreiber. Für beide Seiten ist das eine Befreiung, die einen unerschöpflichen Reigen an Möglichkeiten eröffnet.
Nebenbei weist er darauf hin, dass das — heute vielleicht mehr als je zuvor vorhandene — Wissen und Können im Umgang mit Sprache und Gedichten noch lange keine Experimentierfreudigkeit ist. Stolterfoht bedauert ausdrücklich, dass „die Bereitschaft stark abgenommen hat, ein höheres ästhetisches Risiko einzugehen“ (29). Auch wenn er dann das Gelingen eines Gedichtes eher traditionell als „Regel“-Erfüllung beschreibt, oder besser als: „dass ein zuvor gefasster Plan, sei er formaler und / oder inhaltlicher Art, glückhaft erfüllt wurde“ (29), sollte für Stolterfoht, das macht er unter anderem mit mehrfachen Bezügen auf Diedrich Diederichsen deutlich, aber zumindest ergänzt werden um so etwas wie Authentizität, einen Moment des Kairos vielleicht. Trotz des deutlich betonten Emphatiker-Standpunktes (Lyrik kann alles und ermöglicht Leben erst!) steht dahinter aber genaueste Lektüre und Analyse fremder und eigener Gedichte, ohne die Euphorie des erkennenden (und identifizierenden) Lesens dadurch zu verneinen oder auszuschalten, sondern geradezu zu verstärken.
Und wie konnte es sein, dass ich kein Wort, keinen Satz verstand, und doch genau wusste, dass ich genau das immer hatte lesen wollen, und dass ich es jetzt gefunden hatte, und dass ich nie mehr etwas anderes würde lesen wollen. Das Gefühl, eine Mauer durchbrochen zu haben, einfach so, ganz leicht, ohne jede Anstrengung, und hinter dieser Mauer tat sich etwas auf, ein Raum, ein wirklicher Raum, in dem man würde leben können. (11)
Es ist für mich immer wieder erstaunlich, welch große und großartige Gedichte die Expressionisten in den Jahre während und um den Ersten Weltkrieg schrieben. Und ich entdecke immer wieder, dass ich viel zu wenige davon kenne. Auch Franz Richard Behrens gehört zu diesen Dichtern. Er war eigentlich genau nur in dieser engen Zeitspanne überhaupt dichterisch tätig: Ein einziger Band Lyrik — Blutblüte — ist von ihm 1917 erschienen. Während des Nationalsozialismus kann man ihn vielleicht zur „Inneren Emigration“ zählen, 1961 übersiedelte er dann nach Ostberlin. Aber die ganzen Jahre bis zu seinem Tod 1977 blieben ohne weitere literarische Veröffentlichungen. Offenkundig war der Weltkrieg da so eine Art Katalysator, der die Lyrikproduktion auslösten/vorantrieb.
Auffällig ist nun, finde ich, wie avanciert diese wenigen Gedichte waren und sind — und wie zeitgemäß und zeitgenössisch sie heute noch erscheinen. Aus allen Gedichten, die Michael Lentz in dieser kleinen Auswahlausgabe für den feinen hochroth-Verlag zusammengestellt hat, spricht eine beeindruckende Intensität und auch eine große Freiheit: Sie sind frei von formalen Zwängen und Traditionen, lassen so ziemlich alle Konventionen hinter sich. Hier erscheint Sprache als reiner Ausdruck, hier spürt man, wie ein Dichter um Ausdrucksmöglichkeit für ganz neue und neuartige Erlebnisse — vor allem die Gewalt und Sinnlosigkeit eines mechanisierten Krieges — ringt. Und wie er sie auch findet und den Vollzug des Erlebens am und im Wort fixiert und nachvollzieht. Ein Moment der Seriatlität gehört dazu, mit minimalistischen Elementen, etwa in „Preußisch“ oder „Quer durch Ostpreußen“. Aber auch gleich das eröffnende „Expressionist Artillerist“ zeigt das, mit der Verschränkung einzelner Gedichtzeilen und einem kontinuierlichen Zählen (ich lese das “Ein-und-zwanzig” etc. als das Abzählen von Sekunden, etwa bis zum Einschlag der Granate …), das ganz geschickt ins Hinken gerät bzw. einzelne Zahlen überspringt, wenn die geschilderte Wahrnehmungsdichte sozusagen steigt und das nicht mehr in einen Vers passt:
[…] Neun-und-zwanzig
die Luft stinkt Millionen Schwefel, Kohle
Blutabsinth
die Luft ist stahl und rein
Ein-und-dreissig
die Granattrichter tüpfeln garnich harmonisch
Zwei-und-dreissig
[…]
Die kunstvoll hergestellte Unmittelbarkeit dieser Lyrik ist, denke ich, kaum zu übersehen. Ein anderes, von Behrens bevorzugtes Element, ist etwa die verbale Nutzung von Adjektiven. Bei aller Direktheit und Lebensnähe sind die Gedichte, das zeigt etwa das titelgebende „Erschossenes Licht“ oder das wunderbare „Italien“, sowohl inhaltlich als auch stilistisch und formal sehr sorgsam konstruiert. (Und außerdem ist das wieder hochroth-typisch ein sehr fein und schön gemachtes Heftlein …)
[…] Schneiden das
Land
in
Streifen.
Begreifen kann das mal
Die Generalstabskarte. Vormarsch im Regen (14)
Hier wäre der Ort, zu sagen, dass ich vollkommen normal bin, auch wenn ich Erzählungen schreibe. Ich weiß, dass dies die Dinge erschwert, aber alles andere an mir ist absolut in Ordnung. (78f.)
„Verspielt, elegant und mit allen Wassern der Postmoderne gewaschen“ behauptet der Klappentext — und hat tatsächlich mal recht. Denn Gospodinov ist ein wahrer Geschichtenerzähler: Es geht ihm wirklich darum, „Geschichten“ zu erzählen, nicht Erzählungen zu schreiben. Der Band ist dann auch richtig interessant und kurzweilig-unterhaltsam, weil Gospodinov dabei ein vielseitiger und vielfältiger, technisch sehr versierter Erzähler ist, was die Figuren und die Storys angeht.
 Abwechslungsreich pendeln die meist sehr kurzen Texte (auf den 140 Seiten finden sich immerhin 19 Erzählungen) zwischen einer sympathischen Weltoffenheit, die sich ausdrücklich auch aufs Phantastische, das eigentlich sowieso normal ist, erstreckt, und einer spürbaren Leichtigkeit — einer Lockerheit des Erzählens, des Lebens, des Wahrnehmens. Gospodinov, der sich bzw. seine Erzähler gerne als Geschichtensammler bzw. ‑aufschreiber, nicht als Geschichtenerfinder inszeniert — vom „Anlocken von Geschichten“ (84) schreibt er an einer Stelle — schafft es dabei, zugleich kosmopolitisch und heimatverbunden zu wirken, zugleich witzig (im Sinne von komisch) und traurig (im Sinne von tiefernst) zu sein. Immer wieder spielen die letzten Tage, die letzten Momente, das endgültige Ende, die Apokalypse als eigentlich ganz schelmisches, gewitztes Unternehmen eine große Rolle in seinen Erzählungen. Das ist schon in der eröffnenden (und titelgebenden) Geschichte „8 Minuten und 19 Sekunden“ so, die die Zeit, die das Licht von der Sonne zur Erde braucht beschreibt — also die Zeit, die bleibt, bis die Erde nach dem Ende der Sonne im Dunkel versinkt. Immer, wenn das nicht passiert, weiß man also, dass noch 8 Minuten 19 Sekunden bleiben … Die Implikationen dieser gleitenden Apokalypse spielt die Geschichte sehr schön und dabei durchaus knapp durch.
Abwechslungsreich pendeln die meist sehr kurzen Texte (auf den 140 Seiten finden sich immerhin 19 Erzählungen) zwischen einer sympathischen Weltoffenheit, die sich ausdrücklich auch aufs Phantastische, das eigentlich sowieso normal ist, erstreckt, und einer spürbaren Leichtigkeit — einer Lockerheit des Erzählens, des Lebens, des Wahrnehmens. Gospodinov, der sich bzw. seine Erzähler gerne als Geschichtensammler bzw. ‑aufschreiber, nicht als Geschichtenerfinder inszeniert — vom „Anlocken von Geschichten“ (84) schreibt er an einer Stelle — schafft es dabei, zugleich kosmopolitisch und heimatverbunden zu wirken, zugleich witzig (im Sinne von komisch) und traurig (im Sinne von tiefernst) zu sein. Immer wieder spielen die letzten Tage, die letzten Momente, das endgültige Ende, die Apokalypse als eigentlich ganz schelmisches, gewitztes Unternehmen eine große Rolle in seinen Erzählungen. Das ist schon in der eröffnenden (und titelgebenden) Geschichte „8 Minuten und 19 Sekunden“ so, die die Zeit, die das Licht von der Sonne zur Erde braucht beschreibt — also die Zeit, die bleibt, bis die Erde nach dem Ende der Sonne im Dunkel versinkt. Immer, wenn das nicht passiert, weiß man also, dass noch 8 Minuten 19 Sekunden bleiben … Die Implikationen dieser gleitenden Apokalypse spielt die Geschichte sehr schön und dabei durchaus knapp durch.
Außerdem ist auch eine der „schönsten“ Geschichten zum 11. September hier zu finden: „Do not disturb“. Die erzählt von einem just für diesen Moment als Sprung aus dem Hochhausfenster eines New Yorker Hotels geplanten Selbstmord. Und da Gospodinov ein schwarzer Erzähler ist, gibt es natürlich kein Happy End — der Selbstmord findet dann zwar nicht statt, wird aber natürlich später nachgeholt. Das klingt in der knappen Nacherzählung etwas banal — aber darum geht es Gospodinov ja nicht nur. Zwar sind seine Erzählungen ohne ihre Handlung nicht zu denken, ihre Wirkung erlangen sie aber nicht zuletzt durch die geschickte und gelassen-verspielte erzählerische Inszenierung, die das zu einer sehr kurzweiligen Lektüre werden lässt.
Außerdem kam es mir so vor, als finge Z. an, die Geschichte zu ruinieren, indem er ihr mehr Pathos und Literarizität verlieh als notwendig. Und ich war immerhin der Käufer dieser Erzählung. (54)
außerdem gelesen:
- Judith Zander: Manual numerale. München: dtv 2014.
- Michael Braun, Michael Buselmeier: Der gelbe Akrobat 2. 50 deutsche Gedichte der Gegenwart, kommentiert. Neue Folge (2009–2014). Leipzig: Poetenladen 2016. 18 Seiten.
- Roland Barthes: Das Neutrum. Vorlesung am Collège de France 1977–1978, hrsg. v. Eric Marty, übers. von. Horst Brühmann. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. 346 Seiten.
- Dieter Hein: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. München: Beck 2015. 132 Seiten.
- Christoph Kleßmann: Arbeiter im ‘Arbeiterstaat’ DDR. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen 2014. 141 Seiten.
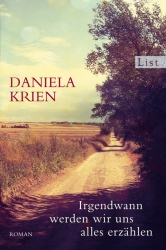 Naja, das war keine so lohnende Lektüre … Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin (wäre ein Grund, dem Rezensenten/der Rezensentin Vertrauenspunkte zu entziehen …). Die Geschichte ist schwach und teilweise blöd: Ein junges Mädchen zieht kurz vor den Sommerferien auf dem Bauernhof der Familie ihres älteren Freundes ein, vernachlässigt die Schule und gibt sich lieber einer seltsamen geheim gehaltenen Beziehung zu dem mehr als doppelt so alten Nachbarbauern hin, die vor allem auf ihrer Ausnutzung und ihrem Missbrauch (körperlich, sexuell und psychisch) beruht und natürlich tragisch enden muss …
Naja, das war keine so lohnende Lektüre … Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin (wäre ein Grund, dem Rezensenten/der Rezensentin Vertrauenspunkte zu entziehen …). Die Geschichte ist schwach und teilweise blöd: Ein junges Mädchen zieht kurz vor den Sommerferien auf dem Bauernhof der Familie ihres älteren Freundes ein, vernachlässigt die Schule und gibt sich lieber einer seltsamen geheim gehaltenen Beziehung zu dem mehr als doppelt so alten Nachbarbauern hin, die vor allem auf ihrer Ausnutzung und ihrem Missbrauch (körperlich, sexuell und psychisch) beruht und natürlich tragisch enden muss …
Das Setting im Sommer 1990 auf der Noch-DDR-Seite der Grenze ist auch nicht so spannend, gibt aber Gelegenheit, ein bisschen (freilich nur wenig) Politik und Geschichte einzuflechten — und ist natürlich ein Spiegel der Figur Maria: In der Zwischenzeit — nicht mehr Kind, noch nicht Erwachsene — spiegelt sich das Land zwischen DDR und BRD … Aber da die Figuren alle reichlich blass bleiben, von der Erzählerin über ihre Restfamilie bis zu Johannes und Henner, kann sich da sowieso kaum etwas entfalten. Das merkt man sehr deutlich an der mühsam inszenierten Intertextualität: Maria wird gerne als begeisterte Leserin porträtiert, liest aber wochen-/monatelang an Dostojewskis Die Brüder Karamasow herum, was natürlich wenig ergiebig ist (sowieso ist Lektüre hier immer ausschließlich eine identifikatorische …). Auch die Komposition von Irgendwann werden wir uns alles erzählen ist nicht weiter bemerkenswert, eher kleinteilig angelegt, mit Schwächen in der Zeitgestaltung. Und die so gelobte Sprache — wenn man den Blurbs im Taschenbuch (ganze zwei Seiten vor dem Titel!) glauben darf — hat für mich keinen Reiz, weil sie eigentlich doch recht gewöhnlich ist.
alles in allem die übersteigerten Gefühle einer Siebzehnjährigen in den Wirrungen einer unruhigen Zeit. (234f. — mehr muss man kaum sagen ;-) …)
Eine schöne Idee der kontrafaktischen Geschichte: NS-Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und sich die halbe Welt untertan gemacht (der Rest gehört zu „Soka Gakkai“), Juden gibt es (fast) keine mehr. Dann stirbt Hitler aber in den 60ern und wird durch Ivo Klöpfel ersetzt — oder ist das ein Mord und Staatsstreich? Die entsprechenden Vermutungen kursieren und geben der Handlung im gleichzeitigen Bürgerkrieg und dem durch die beiden Großmächte entfesselten atomaren Krieg ordentliche Verwicklungen und Handlungsantrieb. Dazwischen treibt Höllriegel umher, ein „Pendler“/Gyromant, der verschwörungstechnisch in die große Politik gerät und sich wieder rauswurschtelt (hat etwas vom Schelm, diese Figur: wenig Ahnung, dafür aber viel Situationsgeschick) und dessen Treiben noch verquickt wird mit seiner Liebe bzw. seinem Begehren nach der (scheinbar) idealen (in ideologischer, d.h. rassentypologischer Sicht), aber unter normalen Umständen unerreichbaren Ulla. Das ganze Gewusel endet dann etwas desillusionierend im Tod — allerdings nicht durch Verstrahlung (das hätte noch etwas gedauert), sondern im Gefecht.
Schön an Basils Roman ist die konsequente Weiterführung, das Zu-Ende-Denken der NS-Ideologie mit ihren Auswüchen, den Gruppen, dem Einheitswahn, der unerschöpflichen Kategorisierungssucht etc. Insgesamt leidet das Buch aber daran, dass es diese kontrafaktische Welt zu sehr beschreibt und nicht durch Handlungen sprechen lässt. Wunderbar sprechend sind dagegen die vielen, vielen Namen … Jedenfalls eine durchaus unterhaltsame Lektüre.
Doch Adolf Hitler war nicht mehr, Odin hatte seinen Meldegänger zum großen Rapport nach Walhall gerufen. (50)
Eine wunderbare Spielerei ist dieses kleine, feine Büchlein (schon die ISBN: in römischen Ziffern, eine echte Fleißarbeit …), eine nette Camouflage, echtes Schelmenstück (der Autor scheint ein in der Wolle getränkte Schelm zu sein …). Der Wahrhafftige Bericht ist eine Art philologische Fantasy (der Bezug auf Tolkien taucht sogar im Vorwort auf), nur in die Vergangenheit verlegt: Es handelt sich um den (fiktiven) Bericht eines gelehrten Landpfarrers, der von einer Giftmischerin/Zigeunerin/Heilkundigen mit den Elfen seines Tales bekannt gemacht wird und Grundzüge (d.h. vor allem Phonetik und Morphologie) ihrer Sprache beschreibt. Das ist eingebettet und kombiniert mit dem Tagebuch der „Entdeckung“ dieser geheimen (?) Sprache bis zum Kriminalfall des Verschwindens sowohl des Pfarrers als auch seiner Informantin (ein Wechseln ins Elfenreich liegt ganz märchentypisch nahe, weil keine Leiche gefunden wird …). Leider fehlt ausgerechnet die Lexik der Elfensprache in den “Aufzeichnungen”, so dass die Fragmente, die „Oestermann“ „überliefert“, dummerweise unverständlich bleiben (aber wer weiß, vielleicht haben sie ja sogar eine Bedeutung? — Das wäre eine schöne Aufgabe für einen Computer mit einem findigen Programmierer …). Das ganze ist von Buchmann verflixt geschickt vorgetäuscht oder gefälscht oder nachgeahmt oder parodiert worden. Von dem Drumherum ist allerdings nicht alles gelogen — das „Gelehrten-Lexicon“ von Jöcher z.B., aus dem zitiert wird, gibt es durchaus — allerdings ohne den hier abgedruckten Eintrag zu Oestermann. Und dann ist das Ganze — es ist ja nicht viel, kaum mehr als vierzig Seiten beanspruchen die “überlieferten” Texte samt editorischen Vorworten und Anhängen von dem kleinen Leipziger Dichter-Verlag Reinecke & Voß sehr schön herausgebracht worden, mit angenehm passendem Satz und schönen Schriften.
Wir fassen die Lettern und stoßen auf | Klänge; wir fassen die Klänge und stoßen auf Namen; wir fassen die Namen und stoßen auf Nichts. (15f.)
Und gleich noch ein schmales Bändchen von Reinecke & Voss, den Hörspieltext Das deutsche Dichterabzeichen. des großen Lyrikers Ulf Stolterfoht. Dichtung und vor allem die Lyrik wird hier als streng reguliertes, entbehrungsreiches Handwerk inszeniert (ein bisschen wie eine moderne Variante der Meistersinger …), das ist ganz nett ausgedacht. Zugleich ist es aber auch noch eine “Systematik“ der Lyrik mit verschiedenen „lyrischen Typen”. Da heißt es zum Beispiel:
Wildtexte, die noch vor Zeiten weite Teile Europas besiedelten, haben sich mittlerweile den immer spezielleren Anforderungsprofilen unterworfen. (17)
Weiter geht es im belehrenden Gespräch über die Dichter-Ausbildung, also die handwerkliche Komponente des Dichtens. Weiteres, ganz wichtiges Thema: Die kompetitive Komponente des Dichtens, die Lesungen und die Wettbewerbe. Das führt Stolterfoht als Zirkus vor, als eine Art Dressur, in der die Dichter die Rolle der Tierchen übernehmen: possierlich, gut für die Unterhaltung, aber nicht ernst zu nehmen … In der Radikalität, in der diese messenden und vergleichende Komponente der Dichtung übergestülpt wird, ist das natürlich — daraus macht der Text kein großes Geheimnis — eine Parabel auf den deutschen Literaturbetrieb der Gegenwart. Aber eine — ganz wie es das Thema verlangt — unterhaltende, in der sich durchaus — schließlich ist Stolterfoht selbst ein intelligenter Teilnehmer — wahre und treffende Beobachtungen finden:
Im Zeitalter hoch entwickelter Prosa hat das Gedicht an Bedeutung verloren. in dem Maße aber, in dem es aus seiner natürlichen Umgebung verschwindet, wächst seine Beliebtheit als domestizierter Wettbewerbstext. (7)
Schön auch kurz vor Schluss:
Etwas ganz besonderes verbirgt sich hinter der Bezeichnung „Vielseitigkeitsprüfung“: Der Dreikampf nämlich aus Lyrik, lyrischer Übersetzung und Poetologie — das alles an drei aufeinander folgenden Tagen. (40)
Mit diesem Buch habe ich mir Kempowski verleidet, das ist zum Abgewöhnen …
Hamit — die dialektale Variante von “Heimat” — ist ein Tagebuch der Zeit direkt während bzw. nach der Wende. Für Kempowski heißt das: Er kann wieder Rostock besuchen, die Stadt, in der er aufwuchs. Und auch Bautzen, wo er eingekerkert war. Weitere Themen des Tagebuchs: Die Medien — wie sie über Politik und über ihn berichten -, die Fertigstellung von Alkor, Zwistigkeiten, Besuche etc. Dazwischen taucht noch die Sammlung von Tagebüchern und Erinnerungen anderer Leute immer wieder auf (fürs sein Echolot und um’s dem „Vergessen zu entreißen“), auch die Politik der Gegenwart spielt natürlich eine Rolle, gerade hinsichtlich des Vereinigungsprozesses. Das ist aber auch der Bereich, wo Kempowski vor allem seinen Animositäten freien Lauf lässt: Außer ihm (und wenigen anderen) hat niemand je etwas kapiert, sehen alle die Widersprüche und Probleme nicht. Dabei ist das kein ganz reines Tagebuch, es ist mindestens zwei Mal überarbeitet (und damit endgültig literarisiert) worden. Aber auch die Anmerkungen aus den 2000ern verstärken die Tendenz der Besserwisserei noch lassen ihn als den einzigen „Weisen“ und das große Genie erscheinen, dass die anderen einfach nicht erreichen. Dabei ist der ganze Text durchtränkt von Ressentiments gegen so ziemlich alle und jeden (mit Ausnahme vielleicht bestimmter Bereiche der Vergangenheit). Und eine große Eitelkeit bricht sich immer wieder Bahn: Alle, die Leser, der Literaturbetrieb, die Medien und die Kritik, aber auch sein Verlag, alle verkennen seine Genialität und seine Leistungen. Dabei ist er doch unersetzlich, wie er ganz typisch bescheiden festhält:
Ich gebe der Gesellschaft ihre Geschichten zurück. (284)
Was würden wir Armen also nur ohne ihn tun!
Mir war der Kempowski, der sich hier zeigt, jedenfalls ausgesprochen unsympathisch. Lustig am Rande auch: Bei einem Verdienst von 50.000 DM/Monat bzw. 1200 DM/Tag (321) beschwert er sich immer wieder darüber, dass er Restaurantrechnungen bezahlen muss/soll: total ichzentriert eben, der Schreiber dieser Seiten, der sich vor allem durch seine Kauzigkeiten — wie die total kontingent scheinende Ablehnung der Worte „Akzeptanz“ und „Dirigat“ (329) — auszeichnet.
Wenn niemand eine Biographie über mich schreibt, tue ich es eben selbst. (177)
“Für sich” steht als Widmung in diesem Gedichtband. Und das stimmt einerseits, andererseits aber auch überhaupt nicht. Zwar stehen die Gedichte erst einmal “für sich” da, geben sich recht offen und direkt dem Leser preis. Aber andererseits bleiben sie auch gerade nicht “für sich”, denn Halter geizt nicht mit intertextuellen Anspielungen und Verweisen. Gerade die Musik spielt da durchaus eine große Rolle. Und dennoch: Man muss diese Intertextualitäten nicht erkennen, man muss ihnen schon gar nicht nachgehen (obwohl das durchaus spannend sein könnte, das systematisch zu tun), um die Lyrik Halters verstehen zu können. Oder zumindest glauben zu können, etwas verstanden zu haben. Denn seine Gedichte bleiben zugänglich und wollen das wohl auch sein. Oft sind sie geradezu erzählend, ihre Metaphern bleiben leicht nachvollziehbar, die Form klar und übersichtlich. Manchmal wirkt das mit dem lockeren Sprachduktus, dem leichten Ton mir aber auch etwas zu plätschernd, zu prosa-nah, zu wenig formbestimmt für Lyrik.
Doch gibt es durchaus schöne und spannende Text in diesem Band. Da zeigt sich nicht nur die Verwurzelung Halters und Tradition und Intertextualität (seine Gedichte schöpfen viel aus oder mit der Kultur und ihrer Geschichte), da ist auch ein anregendes Spiel mit sich selbst immer wieder zu beobachten, die Selbstreflextion des Lyrikers und des Gedichtes zu erkennen. Interessant ist auch das immer wieder auftauchende Zeitkonzept — ein sehr vages Konzept von Zeit, das nicht auf das Trennende von Vergangenheit und Gegenwart abzielt, sondern auf den Übergang, die fließende Entwicklung: Vom Holozän bis zum Jetzt und dem Augenblick sind einzelnen Momente kaum zu fassen und zu bestimmen:
Etwas hat begonnen, dauert an oder ist vorüber. (25)
Nicht alles ist sprachlich oder inhaltlich sehr stark, gerade im Abschnitt IV („O, aufgeklärtes Leben, unsere Droge!“ überschrieben) scheinen mir einige schwache Texte den Weg in den Druck gefunden zu haben. Die Digital-Skepsis in „Hypnose“ ist zum Beispiel ziemlich oberflächlich und billig. Dazwischen gibt es aber immmer wieder schöne Momente, die das Lesen dennoch lesenswert mache, wie etwa die „Eine sich stets wiederholende Szene“:
Die sich leerenden Straßen
an einem Sommerabend
in einer kleinen Stadt.
Das Rücklicht des letzten Busses,
ein leichter Wind, der geht.
Im Ohr ein Lied über
das Ende einer Freundschaft.
außerdem noch:
- Jost Amman & Hans Sachs: Das Ständebuch (1568).
- Georges Duby: Die Zeit der Kathedralen.
Eine Schande, dass ich das erst jetzt lese — irgendwie hat sich das immer wieder in meinem Stapel ungelesener Bücher versteckt. Dabei bin ich ein großer Bewunderer und Schätzer der Stolterfoht’schen Dichtkunst, seine “fachsprachen”-zyklen habe ich mit großer Begeisterung gelesen. holzrauch über heslach ist denen ganz ähnlich, und doch ganz anders: In strengen, metrisch klaren sechs-versigen Strophen, aufgeteilt in neun Teile zu 36 Strophen (und einen kurzen Prolog), schreibt Stolterfoht ein Porträt des Örtchens Heslach. Oder lässt schreiben, denn wie gewohnt nutzt er eine Mischung aus ecriture automatique, massivster Intertextualität, Zitaten und Allusionen, gepaart mit einer unbändigen deskriptiven Phantasie — das ist sehr eindrücklich und faszinierend. Und wer einen Text unter ein Motto aus Klaus Hoffers Bei den Bieresch-Romanen stellt, der hat bei mir sowieso fast schon gewonnen. Zu Recht ist das von der Kritik ein “ethnologisches” Gedicht genannt worden. Denn genau das macht Stolterfoht: Er nimmt den ethnologischen Standpunkt ein und findet dafür, für seine Beschreibung der Wirklichkeit (s)einer Jugend in Heslach in den 1970er Jahren, eben eine eigene poetische Sprache, so dass Inhalt und Form zu einer faszinierenden Deckung kommen. Wenn schon autobiographisches Schreiben, dann bitte doch so.
Nun ja, auch wenn (fast) alle begeistert sind: Ich fand das nur mäßig — mäßig überraschend, mäßig originell, mäßig lustig. Natürlich ist die Idee ganz nett und erstmal auch witzig, Hitler im Herbst 2011 aus einer Art Schlaf nach dem missglückten Selbstmordversuch mit Kopfschmerzen aufwachen zu lassen, ihn auf die veränderte Gegenwart mit ihren neuen Medien und Gewohnheiten treffen zu lassen. Aber da wird es schon schwierig: Dieses Aufeinandertreffen ist schon nicht so spannend und komisch (oder wenigstens tragisch), wie es hätte sein können und eigentlich müssen. Dass Hitler dann als scheinbar perfekter Komödiant gleich beim Fernsehen landet, ist auch eine nette Idee. Aber die Leute und das Geschehen beim Fernsehen ist schon wieder so oberflächlich und banal geschildert, dass es nicht einmal die Oberflächlichkeit und Banalität des Fernsehens abbilden kann. Und so geht das halt dann weiter — zum “literarischen Kabinettstück erster Güte”, dass der Umschlag verheißt, ist da noch ein gutes Stück Weg …
Das ist auch so ein seltsames Büchlein. Stadler, der ja als Romancier sogar den Georg-Büchner-Preis bekam (auch wenn ich nie so recht verstand, warum), schickt seiner Auseinandersetzung mit Adalbert Stifter vorsichtshalber eine “Notiz” voran. Da heißt es:
Dies ist kein Sachbuch, sondern eine — vielleicht sonderbare — Liebeserklärung. […] Es ist ein Vergegenwärtigunsversuch von einem, der selbst schreibt, Romane und so weiter. Der Versuch einer Liebeserklärung, ein Essay.
Und das ist es auch, da hat er schon recht. Dabei ist es aber nicht nur vielleicht, sondern wirklich sonderbar und seltsam. Er berichtet von seiner Lektüre und vom Leben Stifters — aber immer ungeheur sprunghaft und wie unkonzentriert wirkend. Kluge Beobachtungen, vor allem zu Stifters
Ames ist ein Genie — ein Genie, das sich (so ist mein Eindruck bisher) nicht immer ganz im Griff hat: Vieles ist einfach großartig, auch hier, in sTiL., manches aber auch manieristisch und aufgesetz und nervig. Aber, davon bin ich ja felsenfest überzeugt, das Scheitern gehört zum Gelingen immer dazu: Nur wer den Untergang wagt, kann den Gipfel erreichen. Jedenfalls: Mir macht solche Poesie großen Spaß — mehr dazu im passenden Blogeintrag.