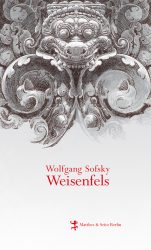 “Unabdingbare Erschütterung”, “verfallene Gemäuer”, “die Begegnung zweier Menschen im Zenit des Untergangs einer verlorenen Welt” — der Umschlagtext hält sich nicht zurück. Dabei ist Weisenfels eigentlich ein ziemlich seltsamer Roman: Zwei (ehemalige) Freunde treffen sich im Familiensitz des einen, einem verfallenden Schloss, dass gefüllt ist mit Artefakten der abendländischen Kunst- und Kulturgeschichte — aber nicht mit Menschen. Die beiden wandeln durch die Gemäuer und durch die Sammlungen und durch die Erinnerung an eine Welt oder eine Epoche, die nicht mehr verfügbar ist — eine Unternehmung, die ganz folgerichtig nur mit dem Tod enden kann. Es war nicht so sehr der plot, der mir schwerfiel, sondern die sehr seltsame Prosa, die Sofsky hier pflegt. Das ist ein unentwegtes Deklarien, Dozieren und Deklamieren, sowohl der Figuren als auch des Erzählers. Überhaupt die Figuren, die sind auch sehr seltsam — nämlich eigentlich nur (noch) als Maske, als Rolle oder als Platzhalter präsent und damit untote Hüllen, leblose Überreste einer einst lebendigen Welt (dem christlichen Abendland, das mit seiner Tradition und Bildung so gerne beschworen wird, aber schon lange nicht mehr lebendig ist …). Religion und ihre Anziehungskraft, aber auch ihre Ausprägungen, Praxen und Theologien spielen eine große Rolle, vor allem aber ein ganz wörtlich genommenes Leben „in“ Kulturen: Wenn hier überhaupt noch Leben ist, dann im Überrest der Kultur, nicht aber in dem, was man Welt nennen möchte.
“Unabdingbare Erschütterung”, “verfallene Gemäuer”, “die Begegnung zweier Menschen im Zenit des Untergangs einer verlorenen Welt” — der Umschlagtext hält sich nicht zurück. Dabei ist Weisenfels eigentlich ein ziemlich seltsamer Roman: Zwei (ehemalige) Freunde treffen sich im Familiensitz des einen, einem verfallenden Schloss, dass gefüllt ist mit Artefakten der abendländischen Kunst- und Kulturgeschichte — aber nicht mit Menschen. Die beiden wandeln durch die Gemäuer und durch die Sammlungen und durch die Erinnerung an eine Welt oder eine Epoche, die nicht mehr verfügbar ist — eine Unternehmung, die ganz folgerichtig nur mit dem Tod enden kann. Es war nicht so sehr der plot, der mir schwerfiel, sondern die sehr seltsame Prosa, die Sofsky hier pflegt. Das ist ein unentwegtes Deklarien, Dozieren und Deklamieren, sowohl der Figuren als auch des Erzählers. Überhaupt die Figuren, die sind auch sehr seltsam — nämlich eigentlich nur (noch) als Maske, als Rolle oder als Platzhalter präsent und damit untote Hüllen, leblose Überreste einer einst lebendigen Welt (dem christlichen Abendland, das mit seiner Tradition und Bildung so gerne beschworen wird, aber schon lange nicht mehr lebendig ist …). Religion und ihre Anziehungskraft, aber auch ihre Ausprägungen, Praxen und Theologien spielen eine große Rolle, vor allem aber ein ganz wörtlich genommenes Leben „in“ Kulturen: Wenn hier überhaupt noch Leben ist, dann im Überrest der Kultur, nicht aber in dem, was man Welt nennen möchte.
Der Verlust der Bildung und der Kultur ist sozusagen die Grundthese, von der aus dieser Text geschrieben ist. Der kokettiert aber zugleich selbst auf allen Ebenen und aufdringlich permanent damit, mit dem Bildungswissen seiner Protagonisten bzw. deren Erzähler: Tabak, Whiskey, Renaissance-Malerei, Kunstmusik des 19. Jahrhunderts, Literatur, Enzyklopädistik, Skulpturen — alles ist hier da, präsent und wird erzählt. Man könnte auch sagen: Das ist lauter bedeutungsschwangeres Wissen-Geklingel … Denn die Idee ist schnell klar, ebenso schnell zeigen sich Längen im Text, der manchmal recht zäh daherkommt. Denn auch ihm gelingt natürlich nicht das, was im und mit dem Schloss versucht wird: Der Versuch, den ewigen Prozess des Zerfallens und Verfalls anzuhalten, den Verlust zu vermeiden: Deshalb das manische Sammeln und Rekonstruieren verlorener Bildungs- und Kulturgüter — ein Versuch, der nahezu zwangsläufig mit dem Verlust der Erinnerungen, des Selbst und des Lebens — also dem Tod — enden muss.
 Mit dem “dünnen Faden” konnte Strobel mich nicht so recht begeistern. “Schnörkellose Schilderungen des mühsam unterdrückten Alptraums im Häuschen im Grünen” verspricht der Schutzumschlag. Das trifft die Erzählungen auch ziemlich genau, verschweigt aber, dass sie dabei eher fad herüberkommen — unter anderem, weil das Muster schnell erkannt ist: Es geht um einbrechende Gefahren, Drohung, Androhungen und Streit. Immer wieder wird der Alltag durch ein plötzlich über die Protagonisten herbrechendes Unheil, ein Unglück und Tragik, in der Realität des Figurenlebens oder auch nur in Gedanken, Träumen und Ahnungen, unterbrochen. Das besondere bei Strobel ist dabei, dass gerade die Momente der Erwartung des Unheils, das spürbare, aber (noch) nicht zu benennende (und damit auch nicht zu hegende) Brodeln unter der Oberfläche des gewönlichen Alltags eine große Rolle spielt. Vieles ist und bleibt dabei auffallend unspezifisch — nicht nur Ort, Raum und Zeit, sondern vor allem die Figuren selbst. Das kann man natürlich aus dem erzählten Geschehen — etwa dem Nebeneinanderleben der Paare, der ausgestellten Nicht-Kommunikation — motivieren. Das wird auch dementsprechend ganz unauffällig erzählt, in unmarkiertem Stil und unmarkierter Form. Lauter Normalität — oder eben leider oft: Mittelmaß — also. Klar, der “mühsam unterdrückte Alptraum” ist da: unter den Oberflächen brodelt es gewaltig. Aber der Text verrät das kaum, seine „schnörkellose Schilderungen“ bleiben selbst schrecklich oberflächlich und vom Geschehen oder dessen Ahnung und Ankündigung gänzlich unberührt. Wofür dann die Stilverknappung, die künstliche Kunstlosigkeit gut ist, erschließt sich mir also nicht wirklich. Alles in allem überzeugen mich diese Erzählungen also leider überhaupt nicht.
Mit dem “dünnen Faden” konnte Strobel mich nicht so recht begeistern. “Schnörkellose Schilderungen des mühsam unterdrückten Alptraums im Häuschen im Grünen” verspricht der Schutzumschlag. Das trifft die Erzählungen auch ziemlich genau, verschweigt aber, dass sie dabei eher fad herüberkommen — unter anderem, weil das Muster schnell erkannt ist: Es geht um einbrechende Gefahren, Drohung, Androhungen und Streit. Immer wieder wird der Alltag durch ein plötzlich über die Protagonisten herbrechendes Unheil, ein Unglück und Tragik, in der Realität des Figurenlebens oder auch nur in Gedanken, Träumen und Ahnungen, unterbrochen. Das besondere bei Strobel ist dabei, dass gerade die Momente der Erwartung des Unheils, das spürbare, aber (noch) nicht zu benennende (und damit auch nicht zu hegende) Brodeln unter der Oberfläche des gewönlichen Alltags eine große Rolle spielt. Vieles ist und bleibt dabei auffallend unspezifisch — nicht nur Ort, Raum und Zeit, sondern vor allem die Figuren selbst. Das kann man natürlich aus dem erzählten Geschehen — etwa dem Nebeneinanderleben der Paare, der ausgestellten Nicht-Kommunikation — motivieren. Das wird auch dementsprechend ganz unauffällig erzählt, in unmarkiertem Stil und unmarkierter Form. Lauter Normalität — oder eben leider oft: Mittelmaß — also. Klar, der “mühsam unterdrückte Alptraum” ist da: unter den Oberflächen brodelt es gewaltig. Aber der Text verrät das kaum, seine „schnörkellose Schilderungen“ bleiben selbst schrecklich oberflächlich und vom Geschehen oder dessen Ahnung und Ankündigung gänzlich unberührt. Wofür dann die Stilverknappung, die künstliche Kunstlosigkeit gut ist, erschließt sich mir also nicht wirklich. Alles in allem überzeugen mich diese Erzählungen also leider überhaupt nicht.
Die Sprache. Sie ist ein unzureichendes Hilfsmittel, und sie ist das einzige Hilfsmittel. Ein schönes Dilemma. (131)
 Eine maritime Gedichtsammlung. Das Meer mit seiner Bewegung, der Grenze zwischen Land und Wasser, der (möglichen) Fremde und den unbeherrschten und unbeherrschbaren Gewalten spielt hier — der Titel weist darauf hin und das Titel“bild” unterstützt das noch — eine große Rolle. Sind das also Naturgedichte? Nunja, Natur taucht hier eher und vorrangig als Impuls für Wahrnehmung des Menschen und für Poesie auf, sie steht nicht für sich selbst und wird auch nicht so wahrgenommen und beschrieben. Neumanns Gedichte eröffnen oft und gerne einen großen Raum (der Imagination), ohne den auch nur annäherungsweise auszuloten und ohne das auch überhaupt zu wollen. Gewissermaßen wird eine Tür geöffnet, der Blick des Lesers in den Raum gewiesen — und dann alleine gelassen. Schön gemacht und deutlich zeigt das Gedicht “buddelschiff” dieses Verfahren:
Eine maritime Gedichtsammlung. Das Meer mit seiner Bewegung, der Grenze zwischen Land und Wasser, der (möglichen) Fremde und den unbeherrschten und unbeherrschbaren Gewalten spielt hier — der Titel weist darauf hin und das Titel“bild” unterstützt das noch — eine große Rolle. Sind das also Naturgedichte? Nunja, Natur taucht hier eher und vorrangig als Impuls für Wahrnehmung des Menschen und für Poesie auf, sie steht nicht für sich selbst und wird auch nicht so wahrgenommen und beschrieben. Neumanns Gedichte eröffnen oft und gerne einen großen Raum (der Imagination), ohne den auch nur annäherungsweise auszuloten und ohne das auch überhaupt zu wollen. Gewissermaßen wird eine Tür geöffnet, der Blick des Lesers in den Raum gewiesen — und dann alleine gelassen. Schön gemacht und deutlich zeigt das Gedicht “buddelschiff” dieses Verfahren:
das gefühl einer langen reise
aufgeklappte masten
und takelage, das englischeschiffstau zum reißen gespannt
der wind humpelt
auf eingeschlafenen beinendurch die schmale öffnung
im flaschenhals
flaut ab, ein helles pfeifen (55)
Typisch für Neumanns Gedichte ist außerdem ihre Kürze. Immer wieder sind sie durch das Anreißen von solchen Augenblicken der (erkenntnishaften) Wahrnehmung, die dann aber nicht weitergeführt und ausgearbeitet wird, gekennzeichnet. Selten sind sie länger als 10/12 Verse. Formal scheinen sie mir vor allem dem Fließen, dem Flow verpflichtet, ohne erkennbare Regelhaftigkeit. Die Gedichte stehen zwar gerne in Gruppen von drei Versen, aber einen Grund erkenne ich dafür nicht …
Durch die inhaltliche und formale Kürze — wenn man das mal so nennen mag — kommt es manchmal zur Überfülle der visuellen und sprachlichen Bilder, die angehäuft, nebeinander gesetzt werden, aber im Text kaum beziehungen zueinander haben — außer eben dem vor allem als (ausgesparten) auslösenden Moment der Erinnerung an ein Gefühl, eine Empfindung, eine beobachtende Wahrnehmung. Das (fast) rein bildliche Sprechen wirkt dabei für mich etwas übersättigend — man darf wohl nicht zu viel am Stück lesen, dann wird die kunstvolle Schönheit dieser Gedichte schnell etwas schal. Aber es lohnt sich, immer wieder zurück zu kommen.
 Eine schöne Gemeinschaftsarbeit ist dieses Buch über Alfred Andersch, seine letzten Tage als Soldat im Zweiten Weltkrieg, seine Gefangenschaft und vor allem die literarische — oder eben autobiographische? — Verarbeitung dessen in mehreren Anläufen in der Nachkriegszeit, mit der sich Andersch auch und gerade im öffentlichen Diskurs sehr eindeutig und nachhaltig positionierte. Eine Arbeit des biographisches Forschens also. Aber nur bedingt biographisch, denn die drei Autoren betonen wiederholt, dass es nicht primär darum geht, die biographische Dimension fiktionaler Texte in den Blick zu nehmen (das wäre ja auch unsinning und wenig hilfreich), sondern darum, die spezifische Situation von Desertion, Kriegsende und Nachkriegszeit bzw. vor allem ihre Deutung in der Retrospektive zu untersuchen. Da Andersch die autobiographische Dimension der “Kirschen der Freiheit” stark forciert — und damit in der Lektüre und Diskussion des Textes auch erfolreich ist -, lässt sich das vertreten. Zumal die drei Autoren aus Germanistik und Geschichtswissenschaft sich mit weit(er)gehenden Deutungen und Spekulationen zurückhalten, sondern einen starken Fokus auf die Rekonstruktion der Ereignisse um Alfred Andersch im Krieg in Italien, um die (Möglichkeit der) Niederschrift und literarischen Bearbeitung solcher Erlebnisse in der Nachkriegszeit richten. Das ist, auch wenn ich mich für Andersch nur am Rande interessiere, gerade in der Vereinigung verschiedener fachlicher Perspektiven, sehr interessant und aufschlussreich — und trotz der teilweise sehr akribischen Aufarbeitung der militärhistorischen und werkstrategischen Zusammenhänge auch sehr gut — zu lesen.
Eine schöne Gemeinschaftsarbeit ist dieses Buch über Alfred Andersch, seine letzten Tage als Soldat im Zweiten Weltkrieg, seine Gefangenschaft und vor allem die literarische — oder eben autobiographische? — Verarbeitung dessen in mehreren Anläufen in der Nachkriegszeit, mit der sich Andersch auch und gerade im öffentlichen Diskurs sehr eindeutig und nachhaltig positionierte. Eine Arbeit des biographisches Forschens also. Aber nur bedingt biographisch, denn die drei Autoren betonen wiederholt, dass es nicht primär darum geht, die biographische Dimension fiktionaler Texte in den Blick zu nehmen (das wäre ja auch unsinning und wenig hilfreich), sondern darum, die spezifische Situation von Desertion, Kriegsende und Nachkriegszeit bzw. vor allem ihre Deutung in der Retrospektive zu untersuchen. Da Andersch die autobiographische Dimension der “Kirschen der Freiheit” stark forciert — und damit in der Lektüre und Diskussion des Textes auch erfolreich ist -, lässt sich das vertreten. Zumal die drei Autoren aus Germanistik und Geschichtswissenschaft sich mit weit(er)gehenden Deutungen und Spekulationen zurückhalten, sondern einen starken Fokus auf die Rekonstruktion der Ereignisse um Alfred Andersch im Krieg in Italien, um die (Möglichkeit der) Niederschrift und literarischen Bearbeitung solcher Erlebnisse in der Nachkriegszeit richten. Das ist, auch wenn ich mich für Andersch nur am Rande interessiere, gerade in der Vereinigung verschiedener fachlicher Perspektiven, sehr interessant und aufschlussreich — und trotz der teilweise sehr akribischen Aufarbeitung der militärhistorischen und werkstrategischen Zusammenhänge auch sehr gut — zu lesen.
 Diese ganz kleine — aber auch ausgesprochen feine — Auswahl aus dem “Journal” Jules Renards hat der inzwischen leider verstorbene Henning Ritter besorgt und auch selbst übersetzt, der Verlag Matthes & Seitz hat sie in seiner überaus empfehlenswerten Reihe “Fröhliche Wissenschaft” nun veröffentlicht. Das hier vorgelegte ist zwar chronologisch — von 1890 bis 1910 — an- und zugeordnet, aber dennoch kein eigentliches Tagebuch, sondern eher eine Notate-Sammlung (Ritter selbst hat sein ähnliches Unternehmen “Notizhefte” genannt). Man könnte auch sagen: Das sind Extrem-Aphorismen. (Zu überlegen wäre freilich, ob das im Original auch so ist, oder ob das erst durch die darauf abzielende Auswahl des Herausgebers so erscheint.) Denn was Ritter ausgewählt hat und hier veröffentlicht wird, das sind lauter kleine und knackige, treffende und totale Sätze. Das hat natürlich immer wieder ein Hang zum Apodiktischen, beruht aber andererseits auf einer genauen Beobachtung der Welt und ihrer Kunst, die sich mit einer ausgefeilten Präzision der genauesten Formulierung paart.
Diese ganz kleine — aber auch ausgesprochen feine — Auswahl aus dem “Journal” Jules Renards hat der inzwischen leider verstorbene Henning Ritter besorgt und auch selbst übersetzt, der Verlag Matthes & Seitz hat sie in seiner überaus empfehlenswerten Reihe “Fröhliche Wissenschaft” nun veröffentlicht. Das hier vorgelegte ist zwar chronologisch — von 1890 bis 1910 — an- und zugeordnet, aber dennoch kein eigentliches Tagebuch, sondern eher eine Notate-Sammlung (Ritter selbst hat sein ähnliches Unternehmen “Notizhefte” genannt). Man könnte auch sagen: Das sind Extrem-Aphorismen. (Zu überlegen wäre freilich, ob das im Original auch so ist, oder ob das erst durch die darauf abzielende Auswahl des Herausgebers so erscheint.) Denn was Ritter ausgewählt hat und hier veröffentlicht wird, das sind lauter kleine und knackige, treffende und totale Sätze. Das hat natürlich immer wieder ein Hang zum Apodiktischen, beruht aber andererseits auf einer genauen Beobachtung der Welt und ihrer Kunst, die sich mit einer ausgefeilten Präzision der genauesten Formulierung paart.
Ich denke nicht nach: Ich schaue hin und lasse die Dinge meine Augen berühren. (13)
Oft geht es in den Miniatur-Einträgen um die Literatur, noch mehr um das Schreiben an sich, aber auch um die Felder der Kritik und des Journalismus — lauter Zeitlosigkeiten also. Das Ich, sein selbst und seine Tugenden wird dabei genauso unbarmherzig und oft hart beobachtet wie die anderen um ihn und um die Jahrhundertwende herum. Da kann ich sehr viel Zustimmungsfähiges finden — man nickt dann beim Lesen immer so schön mit dem Kopf … -, auch pointiert Überraschendes, aber auch Fragliches. Gerade in seiner Haltung zur Welt, die vor allem aus seiner Absolutierung seiner Individualität resultiert, sehe ich nicht nur Vorbildhaftes.
Das Recht eines Kritikers ist es, seine Grundsätze einen nach dem anderen zu verleugnen, seine Pflicht ist es, keine Überzeugung zu haben. (5)
Was ist das Leben, wenn es nur mit Augen gesehen wird, die nicht Augen von Dichtern sind? (22)
außerdem unter anderem gelesen:
- Alexander Osang: Im nächsten Leben. Reportagen und Porträts. Berlin: Ch. Links 2010. 254 Seiten
- Heinrich Detering: Vom Zählen der Silben. Über das lyrische Handwerk. München: Stiftung Lyrik Kabinett 2009. 28 Seiten.
- Hans-Werner Richter: Die Geschlagenen. München: Kurt Desch 1949. 459 Seiten.
- Siri Hustvedt: The Blazing World. London: Sceptre 2014. 379 Seiten.
- Jürgen Kaube: Im Reformhaus. Zur Krise des Bildungssystems. Springe: zu Klampen 2015 (Zu Klampen Essay). 174 Seiten.
- Isabella Straub: Das Fest des Windrads. Berlin: Blumenbar 2015. 348 Seiten.
- Daniel Martin Feige: Philosophie des Jazz. Berlin: Suhrkamp 2014. 142 Seiten.
- Thomas Hecken: Avantgarde und Terrorismus. Rhetorik der Intensität und Programme der Revolte von den Futuristen bis zur RAF. Bielefeld: Transcript 2006. 158 Seiten.
- Harald Welzer, Dana Giesecke, Luise Tremel (Hrsg.): FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2015/16. Geschichten vom guten Umgang mit der Welt. Schwerpunkt Material. Frankfurt am Main: Fischer 2014. 544 Seiten.
- Benjamin Stein: Ein anderes Blau. Prosa für 7 Stimmen. Berlin: Verbrecher 2015. 107 Seiten.
