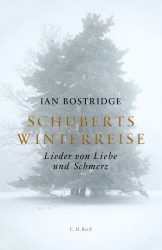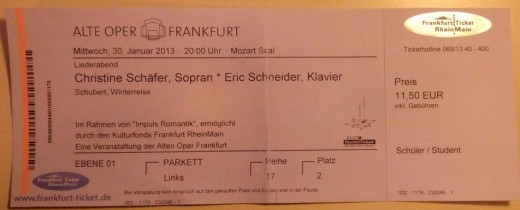Es ist nicht mehr als ein kleiner Ausschnitt der fortdauernden Erkundung des komplexen und schönen Netzes von Bedeutungen – musikalische und literarische, textuelle und metatextuelle –, innerhalb dessen die Winterreise ihren Zauber hervorbringt.S. 396
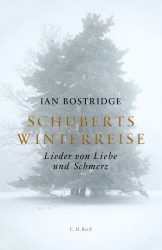 – Mit diesem Schluss endet der britische Tenor Ian Bostridge (übrigens ein ausgebildeter Historiker) sein großes, faszinierendes und in seiner bereichernden Klugheit ausgesprochen lesenswertes Buch über Schuberts Winterreise. Aber es ist ein Satz, der das, was auf den knapp vierhundert Seiten zuvor passiert ist, sehr gut auf den Punkt bringt. Lieder von Liebe und Schmerz hat der deutsche Verlag Bostridges Buch im Untertitel benannt. Das englische Original finde ich passender: Anatomy of an Obsession. Denn beides, das sezierende Untersuchen als auch die obsessive Beschäftigung mit dem Kunstwerk, bringt das Verhältnis von Bostridge zur Winterreise sehr gut auf den Punkt. Und beides, die Analyse und die emotionale Bindung, merkt man dem Text eigentlich auf jeder Seite an: Jede Seite dieses großartigen Buches, das Lied für Lied die Winterreise unter die Lupe nimmt, lässt die obsessive Liebe und die jahrzehntelange Beschäftigung mit Musik und Text, mit Dichter und Komponist, mit Hintergründen und Bedeutungen spüren.
– Mit diesem Schluss endet der britische Tenor Ian Bostridge (übrigens ein ausgebildeter Historiker) sein großes, faszinierendes und in seiner bereichernden Klugheit ausgesprochen lesenswertes Buch über Schuberts Winterreise. Aber es ist ein Satz, der das, was auf den knapp vierhundert Seiten zuvor passiert ist, sehr gut auf den Punkt bringt. Lieder von Liebe und Schmerz hat der deutsche Verlag Bostridges Buch im Untertitel benannt. Das englische Original finde ich passender: Anatomy of an Obsession. Denn beides, das sezierende Untersuchen als auch die obsessive Beschäftigung mit dem Kunstwerk, bringt das Verhältnis von Bostridge zur Winterreise sehr gut auf den Punkt. Und beides, die Analyse und die emotionale Bindung, merkt man dem Text eigentlich auf jeder Seite an: Jede Seite dieses großartigen Buches, das Lied für Lied die Winterreise unter die Lupe nimmt, lässt die obsessive Liebe und die jahrzehntelange Beschäftigung mit Musik und Text, mit Dichter und Komponist, mit Hintergründen und Bedeutungen spüren.
Lied für Lied – diese Gliederung greift das gut gemachte (ich habe – abgesehen von der prinzipiell etwas unsinnigen Übersetzung englischer Übersetzungen deutscher Texte – nur einen Übersetzungsfehler bemerkt – der ist allerdings etwas peinlich, weil er das englische b‑minor mit b‑moll statt h‑moll übersetzt und auf der selben Seite auch noch richtig vorkommt …) und schön ausgestattete Buch auch äußerlich auf. Bostridge folgt damit zwar der Dramaturgie Schuberts (die ja, wie er mehrfach darlegt, von der Reihenfolge Müllers abweicht), gestattet sich aber auch Freiheiten: Manche Kapitel sind auffallend kurz, andere etwas ausschweifend. Manche bieten eine sehr konzentrierte Analyse von Text und Musik, andere liefern vor allem geschichtliche, politische, wirtschaftliche, soziologische Hintergründe. Wie er prinzipielle Beobachtungen und Anmerkungen über die einzelnen Liedkapitel verteilt, das ist sehr geschickt. Die sind dadurch nämlich immer mehr als bloße Kommentare oder Erläuterungen, das Buch wird nicht zu einer seriell-schematischen Analyse, sondern zu einem großen Ganzen: Alles in allem ist das eine großartige Sammlung von Wissen aus allen Bereichen zu den 1820er Jahren. Da liegt aber auch schon eines der Probleme, die ich damit hatte (neben der meist fehlenden Referenzierung des angesammelten Wissens): Bei Bostridge werden die 1820er in Technik, Ökonomie, Gesellschaft und Politik zu einem frühen Höhepunkt der Modernisierung. Ich bin mir nicht so recht sicher, ob das stimmt (und ob es hilfreich wäre). Für ein endgültiges Urteil fehlt mir da freilich etwas Wissen, mir scheinen diese Jahre aber doch mehr Durchgang als Gipfel zu sein.
Ein anderer Punkt, bei dem ich Bostridge immer wieder widersprechen möchte, ist die Ironie. Die findet er in der Winterreise nämlich wesentlich häufiger und stärker als ich das immer nachvollziehen kann. Ähnlich geht es mir mit der politischen Dimension von Text und Musik. In beiden Fällen möchte ich Bostridges Deutungen gar nicht von vornherein verwerfen, sie scheinen mir in diesen Aspekten aber etwas überspitzt. Deutlich wird das etwa bei seinen Ausführungen zum „Köhler“, der (bzw. dessen Hütte, er selbst ja gerade nicht) in der Winterreise genau einmal vorkommt: Das kann man als mögliche politische Chiffre lesen, so zwingend, wie Bostridge das darstellt, ist diese Lesart aber meines Erachtens nicht. Überhaupt hat mich seine politische Lesart vieler Lieder (bzw. eigentlich nur ihrer Texte, in diesem Deutungszusammenhang spielt die Musik keine Rolle) nicht so sehr befriedigt, zumal sie ja doch erstaunlich indifferent bleibt. Ähnlich ist es übrigens um Schubert selbst hier bestellt: Zum einen wird er als politischer Künstler, der extrem unter den harten Bedingungen der vormärzlichen Zensur litt, dargestellt. Zugleich ist er für Bostridge aber auch ein Komponist, der ganz unbedingt ein Ideal des reinen, transzendenten Künstlertums verfolgt – zwei Lesarten, die hier fast nahtlos ineinander übergehen, die ich aber nicht so recht zusammen bekomme.
Das alles macht aber wenig bis nicht. Denn Bostridge zu lesen, ja eigentlich: zu schmökern, ist auf jeden Fall ein großer Gewinn. Zumal das Buch auch, ich sagte es schon, einfach schön ist und auch mit Abbildungen nicht geizt. Schade fand ich allerdings, um das Lob gleich wieder ein bisschen einzuschränken, dass Bostridge so wenig über die Musik und ihre Details spricht. Mein Eindruck war da, dass dieses Element in der Fülle der Zugänge und Materialien, die er zur Winterreise zusammengetragen hat, etwas untergeht. Von einem Sänger hätte ich mir gerade auf diesem Gebiet mehr musikologische Analyse und Beschreibung gewünscht. Aber das wäre dann vielleicht ein anderes Buch geworden.
Es ist nämlich wirklich seltsam mit diesem Buch: Als Ganzes finde ich es immer noch ziemlich großartig, es ist ein (über)reiches Buch, das dem Verständnis der Winterreise auf jeden Fall in großem Maße dient und das Hören (oder Musizieren) ungemein bereichern kann. Im Detail finde ich aber vieles fragwürdig und würde oft widersprechen. Ein paar kleine, fast willkürliche Beispiele: Den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg aus einer typisch deutschen „romantischen Todesbesessenheit“ (118) zu erklären wollen – das ist einfach Quatsch. Oder wenn ein Fermatenzeichen zu einem „allessehenden Auge“ (178) wird. Manchmal ist es auch vor allem eine große Fleißleistung, wenn er etwa zum „Frühlingstraum“ über mehrere Seiten das Vorkommen von Eisblumen in der Kunst- und Literaturgeschichte referiert, was aber weder mit Müller noch mit Schubert in Verbindung steht. Da erschließt sich mir dann nicht so ganz der Zweck, den das für eine Analyse oder Interpretation dieses Kunstwerkes haben soll.
Aber: Die Welt von Schuberts Winterreise kann der überaus gebildete Bostridge mit seinem gesammeltem Wissen und seinen genauen, vielfältigen, emphatischen Beobachtungen eben doch ganz toll entfalten und wunderbar vermitteln. Es ist übrigens kein Versehen, wenn ich von Schuberts Winterreise sprach: Der Schwerpunkt seiner Betrachtungen liegt auf Schubert und seiner Musik, auch wenn der Text und sein Autor, Wilhelm Müller, nicht ganz außen vor bleiben. Auch die Rezeption der Winterreise wird nicht vergessen. Und seine intime Vertrautheit en detail & en gros mit dem Werk sowie seine doppelte Autorität als ausübender Sänger und forschender Historiker tun dem Buch sehr gut: Er weiß, wovon er redet. Und nach der Lektüre seine Buches weiß man auch, was man da eigentlich hört (oder: hören kann!), wenn man der Winterreise lauscht.
Ian Bostridge: Schuberts Winterreise. Lieder von Liebe und Schmerz. 2. Auflage. München: Beck 2015. 405 Seiten. ISBN 978–3‑406–68248‑3.