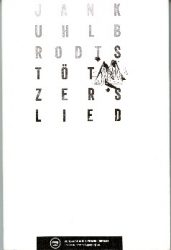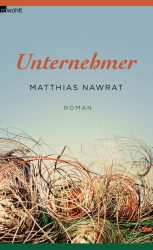Als Biographie ist das für mich kaum satisfaktionsfähig: Zu blass und verschwommen bleibt das Bild. Der Mensch Bismarck, die Person, tritt nahezu gar nicht auf — ab und an gibt es Hinweise auf seine Gesundheit oder ein paar ganz wenige auf Frau und Kinder. Im Vordergrund oder besser alleine im Fokus steht sein politisches Handeln. Das beschreibt Kolb mit Zuneigung, aber durchaus auch mit Blick für die Ambivalenzen Bismarcks. Aber auch das Zentrum, die Politik, bleibt blut- und farblos. Das liegt vor allem daran, dass Kolb oft sehr großzügig durch die Geschehnisse und Taten durch eilt udn nur die Ergebnisse berichtet, den Weg aber meist nur summarisch (und oft genug mit dem Hinweis: Die Details sind bekannt). Das wiederum hängt damit zusammen, dass er keinen rechten Zugriff findet: Eigentlich ist das eine preußische/deutsche Geschichte am Beispiel Bismarcks. Und beides ist in diesem Umfang natürlich kaum besonders intensiv oder tiefgehend zu leisten.
Als Biographie ist das für mich kaum satisfaktionsfähig: Zu blass und verschwommen bleibt das Bild. Der Mensch Bismarck, die Person, tritt nahezu gar nicht auf — ab und an gibt es Hinweise auf seine Gesundheit oder ein paar ganz wenige auf Frau und Kinder. Im Vordergrund oder besser alleine im Fokus steht sein politisches Handeln. Das beschreibt Kolb mit Zuneigung, aber durchaus auch mit Blick für die Ambivalenzen Bismarcks. Aber auch das Zentrum, die Politik, bleibt blut- und farblos. Das liegt vor allem daran, dass Kolb oft sehr großzügig durch die Geschehnisse und Taten durch eilt udn nur die Ergebnisse berichtet, den Weg aber meist nur summarisch (und oft genug mit dem Hinweis: Die Details sind bekannt). Das wiederum hängt damit zusammen, dass er keinen rechten Zugriff findet: Eigentlich ist das eine preußische/deutsche Geschichte am Beispiel Bismarcks. Und beides ist in diesem Umfang natürlich kaum besonders intensiv oder tiefgehend zu leisten.
 Manituana reicht leider nicht an die letzten Bände von Wu Ming heran. Das kann durchaus daran liegen, dass der USA, ihre Unabhängigkeitskrieg und der Kampf mit, um und gegen die “Indianer” schon an sich nicht so ganz mein Ding sind. Da passiert dann zwar wieder viel, es wird gekämpft, betrogen, verraten und verhandelt, eine Delegation darf auch nach England reisen und sich im Luxus (und den Niederungen Londons) des Adelslebens gehörig fremd fühlen. Ich hatte beim Lesen aber schon eigentlich durchweg den Eindruck, dass das an Spannung und vor allem hinsichtlich des bildhaften, detailreichen Erzählens einfach nicht (mehr) so gut ist. Zu sehr dringt hier immer wieder die Absicht an die Oberfläche und stellt sich vor den Text — und damit funktioniert genau das, was bei anderen Texten von Wu Ming die besondere Spannung und den speziellen Reiz ausmacht, hier leider nicht.
Manituana reicht leider nicht an die letzten Bände von Wu Ming heran. Das kann durchaus daran liegen, dass der USA, ihre Unabhängigkeitskrieg und der Kampf mit, um und gegen die “Indianer” schon an sich nicht so ganz mein Ding sind. Da passiert dann zwar wieder viel, es wird gekämpft, betrogen, verraten und verhandelt, eine Delegation darf auch nach England reisen und sich im Luxus (und den Niederungen Londons) des Adelslebens gehörig fremd fühlen. Ich hatte beim Lesen aber schon eigentlich durchweg den Eindruck, dass das an Spannung und vor allem hinsichtlich des bildhaften, detailreichen Erzählens einfach nicht (mehr) so gut ist. Zu sehr dringt hier immer wieder die Absicht an die Oberfläche und stellt sich vor den Text — und damit funktioniert genau das, was bei anderen Texten von Wu Ming die besondere Spannung und den speziellen Reiz ausmacht, hier leider nicht.
 Das ist ein überraschend feines, kleines Buch. Jan Peter Bremer hatte ich bisher ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber in Der junge Doktorand zeigt er sich durchaus als gewiefter Erzähler, der sein Handwerk versteht und vor allem ernst nimmt: Ernst nehmen in dem Sinn, dass er sich bemüht, sauber zu arbeiten, Fehler zu vermeiden. Das zeigt der Text, der mit Gespür und Formbewusstsein erzählt ist. Das kunstvolle Beherrschen des Erzählens zeigt sich auch in dem Umfang des Buches: Das ist ein kleiner Roman. Es geht auch gar nicht so sehr um große, allumfassende Dinge — die Welt wird hier nicht gerade erzählt. Aber auch wenn er sich bescheiden gibt: Bremer gelingt es doch, auf den wenigen Seiten mit genauen Sätzen, treffenden Beschreibungen und Bewusstsein für das richtige Tempo große Themen zu erzählen: Es geht um Ehe, um Gesellschaft und Individuum, und natürlich, vor allem, um Kunst — und auch ein bisschen um nicht-normierte Lebensläufe wie den des jungen Doktoranden, der weder jung noch Doktorand ist. Das klingt in der Zusammenfassung recht trocken und ja, fast banal, entfaltet bei Bremer aber eine treffenden und subtile Komik. Und das macht dann einfach Spaß.
Das ist ein überraschend feines, kleines Buch. Jan Peter Bremer hatte ich bisher ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber in Der junge Doktorand zeigt er sich durchaus als gewiefter Erzähler, der sein Handwerk versteht und vor allem ernst nimmt: Ernst nehmen in dem Sinn, dass er sich bemüht, sauber zu arbeiten, Fehler zu vermeiden. Das zeigt der Text, der mit Gespür und Formbewusstsein erzählt ist. Das kunstvolle Beherrschen des Erzählens zeigt sich auch in dem Umfang des Buches: Das ist ein kleiner Roman. Es geht auch gar nicht so sehr um große, allumfassende Dinge — die Welt wird hier nicht gerade erzählt. Aber auch wenn er sich bescheiden gibt: Bremer gelingt es doch, auf den wenigen Seiten mit genauen Sätzen, treffenden Beschreibungen und Bewusstsein für das richtige Tempo große Themen zu erzählen: Es geht um Ehe, um Gesellschaft und Individuum, und natürlich, vor allem, um Kunst — und auch ein bisschen um nicht-normierte Lebensläufe wie den des jungen Doktoranden, der weder jung noch Doktorand ist. Das klingt in der Zusammenfassung recht trocken und ja, fast banal, entfaltet bei Bremer aber eine treffenden und subtile Komik. Und das macht dann einfach Spaß.
 Die Winterbienen haben mich etwas enttäuscht und ratlos zurückgelassen. Ich habe Scheuer ja durchaus als erfahrenen Erzähler und Autor schätzen gelernt. Dieser Roman hat aber mehr Schwächen als er mit seinen eher mäigen Stärken ausgleichen kann. Da ist zum einen die seltsame Tagebuch-Fiktion. Die passt nämlich vorne und hinten nicht: Gut, dass der Tagebuchtext in Fußnoten die lateinischen Zitate übersetzt, das wird noch von der Herausgeberfiktion gedeckt. Dass (als ein Beispiel von vielen) Egidius Arimond (schon der Name macht mich ja beinahe wahnsinnig) als erfahrener Imker aber nach jahrzehntelanger Tätigkeit seinem Tagebuch erklärt, was er warum bei den Bienen, vor allem eben im Winter, macht, ist einfach handwerklicher bzw. erzähltechnischer Unsinn, der einer Lektorin durchaus mal hätte auffallen dürfen. Der Roman an sich ist für mich etwas zwiespältig: Natürlich sehr durchdrungen von völkischer Ideologie, die eben wieder durch die Tagebuch-Fiktion legitimiert wird. Dann ist da noch das Leiden eines Krieges, der auf die Aggressoren zurückgefallen wird, hier aber — in Arimond und den restlichen, schemenhaft auftauchenden Eifelbewohnern — eher als irgendwie gegeben hingenommen wird. Angeblich ist die erzählte Welt geprägt von dem “Wunsch nach einer friedlichen Zukunft” — davon merkt man im Text aber reichlich wenig. Im ganzen bleibt mir das etwas fragwürdig und vor allem ausgesprochen unbefriedigend: Warum erzählt Scheuer uns das? Und warum versteckt sich der Autor so (beinahe) vollkommen hinter seiner Figur — was will mir das eigentlich sagen?
Die Winterbienen haben mich etwas enttäuscht und ratlos zurückgelassen. Ich habe Scheuer ja durchaus als erfahrenen Erzähler und Autor schätzen gelernt. Dieser Roman hat aber mehr Schwächen als er mit seinen eher mäigen Stärken ausgleichen kann. Da ist zum einen die seltsame Tagebuch-Fiktion. Die passt nämlich vorne und hinten nicht: Gut, dass der Tagebuchtext in Fußnoten die lateinischen Zitate übersetzt, das wird noch von der Herausgeberfiktion gedeckt. Dass (als ein Beispiel von vielen) Egidius Arimond (schon der Name macht mich ja beinahe wahnsinnig) als erfahrener Imker aber nach jahrzehntelanger Tätigkeit seinem Tagebuch erklärt, was er warum bei den Bienen, vor allem eben im Winter, macht, ist einfach handwerklicher bzw. erzähltechnischer Unsinn, der einer Lektorin durchaus mal hätte auffallen dürfen. Der Roman an sich ist für mich etwas zwiespältig: Natürlich sehr durchdrungen von völkischer Ideologie, die eben wieder durch die Tagebuch-Fiktion legitimiert wird. Dann ist da noch das Leiden eines Krieges, der auf die Aggressoren zurückgefallen wird, hier aber — in Arimond und den restlichen, schemenhaft auftauchenden Eifelbewohnern — eher als irgendwie gegeben hingenommen wird. Angeblich ist die erzählte Welt geprägt von dem “Wunsch nach einer friedlichen Zukunft” — davon merkt man im Text aber reichlich wenig. Im ganzen bleibt mir das etwas fragwürdig und vor allem ausgesprochen unbefriedigend: Warum erzählt Scheuer uns das? Und warum versteckt sich der Autor so (beinahe) vollkommen hinter seiner Figur — was will mir das eigentlich sagen?
außerdem gelesen:
- Heimito von Doderer: Unter schwarzen Sternen. Erzählungen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1973. 154 Seiten. ISBN 3–7642-0055–3.
- Glenn Gould: Freiheit und Musik. Reden und Schriften. 2., durchgesehene und ergänzte Auflage. Ditzingen: Reclam 2019 (Was bedeutet das alles?). 84 Seiten. ISBN 978–3‑15–019412‑6.
- Algernon Blackwood: Eine Kanufahrt auf der Donau. / Die Weiden. Ulm: danube bookes 2018. 154 Seiten. ISBN 978–3‑946046–13‑4.
- Sibylle Schwarz: Ist Lieben Lust, wer bringt dann das Beschwer?. Leipzig: Reinecke & Voß 2016. 58 Seiten. ISBN 978–3‑942901–21‑5.