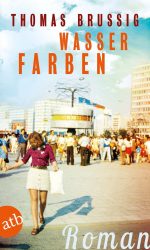 Wasserfarben ist der erste Roman von Brussig, 1991 unter einem Pseudonym erschienen und jetzt als E‑Book veröffentlicht, deshalb ist er sozusagen bei mir gelandet. Es wird erzählt von einem Abiturient in Ost-Berlin am Übergangspunkt zwischen noch Schule und bald Leben. Es soll also ganz offensichtlich ein coming-of-age-Roman sein. Das ist es aber nicht so recht — weil der “Held” sich wenig bis gar nicht entwickelt und erst am Ende von seinem älteren Bruder erklärt bekommt, wie man erwachsen wird … Der Text ist vielleicht typisch Brussig: gewollt rotzig und trotzig. Und dieses bemühte Wollen merkt man dem Text leider immer wieder an — nicht an allen Stellen, aber doch häufig. Genau wie er bemüht “frech” sein will ist er auch etwas bemüht witzig. Vor allem aber fehlt mir die eigentliche Motivation des Erzählers, warum er so ist, wie er ist. Das wird einfach nicht klar.
Wasserfarben ist der erste Roman von Brussig, 1991 unter einem Pseudonym erschienen und jetzt als E‑Book veröffentlicht, deshalb ist er sozusagen bei mir gelandet. Es wird erzählt von einem Abiturient in Ost-Berlin am Übergangspunkt zwischen noch Schule und bald Leben. Es soll also ganz offensichtlich ein coming-of-age-Roman sein. Das ist es aber nicht so recht — weil der “Held” sich wenig bis gar nicht entwickelt und erst am Ende von seinem älteren Bruder erklärt bekommt, wie man erwachsen wird … Der Text ist vielleicht typisch Brussig: gewollt rotzig und trotzig. Und dieses bemühte Wollen merkt man dem Text leider immer wieder an — nicht an allen Stellen, aber doch häufig. Genau wie er bemüht “frech” sein will ist er auch etwas bemüht witzig. Vor allem aber fehlt mir die eigentliche Motivation des Erzählers, warum er so ist, wie er ist. Das wird einfach nicht klar.
Wasserfarben ist dabei sowieso von einem eher lahmen Witz und hinkendem Esprit gekennzeichnet. Das passt insofern, als auch die beschriebene DDR-Jugend in den 80ern so halb aufsässig ist: nicht ganz angepasst, aber auch kein Hang zur Totalverweigerung oder wenigstens “ordentlicher” Opposition. Das, der Held und seine Freunde und Bekannte, denen er im Lauf der Erzählung begegnet, zeigen dafür sehr schön den Druck, den das System aufbauen und ausüben konnte, vor allem in der Schule, aber auch im Privatleben, wo Arnold, der Protagonist und Erzähler (der den Leser schön brav siezt und auch sonst so seine extrem angepassten Momente hat), durchaus aneckt — vor allem wohl aus einem unspezifischen Freiheitsdrang, weniger aus grundsätzlicher Opposition. Das Buch hat durchaus einige nette Momente, die auch mal zum Schmunzeln anregen können, erschien mir auf die Dauer aber etwas fad — so wie die Jugend und die DDR selbst vielleicht. Nicht umsonst beschreiben die sich als “wasserfarben” im Sinne von: diese Jugend hat die Farbe von Wasser, ist also ziemlich blass, durchscheinend, aber auch vielfältig.
Meinen Eindruck dieses feinen Büchleins, dass es mir nach anfänglicher Distanz doch ziemlich angetan hat, habe ich an einem anderen Ort aufgeschrieben: klick.
Diese gelungene Einführung in die frei improvisierte Musik für interessierte Hörer und Hörerinnen habe ich auch schon in einem Extra-Beitrag gelobt: klick.
 Dieser Band versammelt Sprechtexte Gomringers. Die zielen auf die Stimme und ihre körperliche Materialität, sie setzen sie voraus, sie machen sie zu einem Teil des Textes selbst — oder, wie es im Nachwort heißt: “Die Niederschrift ist für sie ein Behelf, um das lyrische schlechthin zur Erfüllung zu bringen.” (144). Das ist gewissermaßen Vorteil und Problem zugleich. Dass man den Texten ihre Stimme sozusagen immer anmerkt, ist konsequent. Und sie passen damit natürlich sehr gut in die “edition spoken script”. Ich — und das ist eben eine rein subjektive Position — mag das allerdings oft nicht so gerne, zu sprechende/gesprochene Texte lesen — da fehlt einfach wesentliche Dimension beim “bloßen” Lesen. Und was übrig bleibt, funktioniert nicht immer, nicht unbedingt so richtig gut. Das soll aber auch gar keine Rüge sein und keinen Mangel anzeigen: Sprechtexte, die als solche konzipiert und geschrieben wurden, sind eben mit bzw. in der Stimme gedacht. Ist ja logisch. Wenn die nun im gedruckten Text wegfällt, fehlt eine Dimension des Textes, die sich imaginativ für mich nicht immer reibungs-/nahtlos ersetzen lässt. Ich denke durchaus, dass mindeste ein Teil der Texte gut sind. Gefallen hat mir zum Beispiel das wiederholte Ausprobieren und Bedenken, was Sprache vermag und in welcher Form: was sich also (wie) sagen lässt. Anderes dagegen schien mir doch recht banal. Und manchmal auch etwas laut und etwas „in your face“, eine Spur zu aufdringlich und über-direkt. Insgesamt hinterlässt der Band damit bei mir einen sehr divergenten, uneinheitlichen Eindruck.
Dieser Band versammelt Sprechtexte Gomringers. Die zielen auf die Stimme und ihre körperliche Materialität, sie setzen sie voraus, sie machen sie zu einem Teil des Textes selbst — oder, wie es im Nachwort heißt: “Die Niederschrift ist für sie ein Behelf, um das lyrische schlechthin zur Erfüllung zu bringen.” (144). Das ist gewissermaßen Vorteil und Problem zugleich. Dass man den Texten ihre Stimme sozusagen immer anmerkt, ist konsequent. Und sie passen damit natürlich sehr gut in die “edition spoken script”. Ich — und das ist eben eine rein subjektive Position — mag das allerdings oft nicht so gerne, zu sprechende/gesprochene Texte lesen — da fehlt einfach wesentliche Dimension beim “bloßen” Lesen. Und was übrig bleibt, funktioniert nicht immer, nicht unbedingt so richtig gut. Das soll aber auch gar keine Rüge sein und keinen Mangel anzeigen: Sprechtexte, die als solche konzipiert und geschrieben wurden, sind eben mit bzw. in der Stimme gedacht. Ist ja logisch. Wenn die nun im gedruckten Text wegfällt, fehlt eine Dimension des Textes, die sich imaginativ für mich nicht immer reibungs-/nahtlos ersetzen lässt. Ich denke durchaus, dass mindeste ein Teil der Texte gut sind. Gefallen hat mir zum Beispiel das wiederholte Ausprobieren und Bedenken, was Sprache vermag und in welcher Form: was sich also (wie) sagen lässt. Anderes dagegen schien mir doch recht banal. Und manchmal auch etwas laut und etwas „in your face“, eine Spur zu aufdringlich und über-direkt. Insgesamt hinterlässt der Band damit bei mir einen sehr divergenten, uneinheitlichen Eindruck.
Modern
Einen Baum pflanzen
Auf ihm ein Haus bauen
Da rein ein Kind setzen
Das Kind zweisprachig
Anschreien (116)
Listening ist das Tourtagebuch des Improvisationstrios LDP, also des Saxophonisten Urs Leimgruber, des Pianisten Jacques Demierre und des Bassisten Barre Phillips. Ursprünglich haben die drei das als Blog geschrieben und auch veröffentlicht. Drei Musiker also, die in drei Sprachen schreiben — was dazu führt, dass ich es nicht ganz gelesen habe, mein Französisch ist doch etwas arg eingerostet. Das geht mal ein paar Sätze, so manches habe ich dann aber doch übersprungen. Und die ganz unterschiedliche Sichtweisen und Stile beim Erzählen des Tourens haben. Da geht es natürlich auch um den Touralltag, das Reisen spielt eine große Rolle. Wichtiger aber noch sind die Veranstalter, die Organisation und vor allem die Orte und Räume, in den sich die Musik des Trios entwickeln kann. Und immer wieder wird die Mühe des Ganzen deutlich: Stunden- bis tagelang fahren, unterwegs sein für ein bis zwei Stunden Musik. Und doch ist es das wert, sowohl den Produzenten als auch den Rezipienten der freien Musik.
The performing musician’s handicap is that each concert is the last one ever. It’s never going to get any better than it is today. The concert is ‚do or die‘ time. This moment is your truth and the groups truth. (65)
Die Räume, Publika und auch die bespielten Instrumente werden immer wieder beschrieben und bewerten. Demierre führt zum Beispiel genau Buch, welche Klaviere und Flügel er bespielt, bis hin zur Seriennummer der Instrumente. Und da ist vom Steinway-Konzertflügel der D‑Reihe bis zum abgewrackten “upright” alles dabei … Leimgruber interessiert sich mehr für die Städte und Organisationszusammenhänge, in denen die Konzerte stattfinden. Und natürlich immer wieder die Musik: Wie sie entsteht und was dabei herauskommt, wenn man in vertrauter Besetzung Tag für Tag woanders neu und immer wieder frei improvisiert. Und wie die Reaktionen sind. Da finden sich, im Text des Tourtagebuch verteilt, immer wieder interessante Reflexionen des Improvisierens und Selbstpositionierungen, die ja bei solcher, in gewisser Weise marginaler, Musik immer auch Selbstvergewisserungen sind. Nur geübt wird eigentlich überhaupt nicht (außer Barre Phillips, der sich nach monatelanger Abstinenz aus Krankheitsgründen wieder neu mit seinem Bass vertraut machen muss). Und im Trio gibt’s immerhin kurze Soundchecks, die aber wohl vor allem der Erprobung und Anpassung an die jeweilige Raumakustik dienen. Und nicht zuletzt bietet der Band noch viele schöne Fotos von Jacques Demierre.
Konzentriertes Hören, Verantwortung, materielle Voraussetzungen und spontane Eingaben bilden die Basis der Musik. Wir agieren, intensivieren, dekonstruieren, eliminieren, addieren und multiplizieren… Wir praktizieren Musik in Echtzeit, sie entsteht, indem sie entsteht. Gesten und Spielweisen vermischen sich und lösen sich ab. Wir halten nichts fest. Das Ausgelassene zählt genauso wie das Eingefügte. Jedes Konzert ist auf seine Art ein Original. Jede Situation ist anders. Der akustische Raum, das Publikum, die gesamte Stimmung im Hier und Jetzt. (134f.)
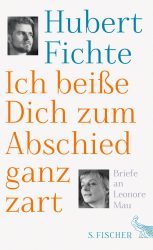 Zusammengerechnet sind es knapp 60 Seiten Briefe, für die man 26 Euro bezahlt. Und viele der Briefe Hubert Fichtes an seine Lebensgefährtin Leonore Mau sind (sehr) knappe, kurze Mitteilungen, die oft in erster Linie die Banalitäten des (Zusammen-)Lebens zum Inhalt haben.
Zusammengerechnet sind es knapp 60 Seiten Briefe, für die man 26 Euro bezahlt. Und viele der Briefe Hubert Fichtes an seine Lebensgefährtin Leonore Mau sind (sehr) knappe, kurze Mitteilungen, die oft in erster Linie die Banalitäten des (Zusammen-)Lebens zum Inhalt haben.
Ich will: keinerlei familiäre Bindungen. Ich will frei leben — als Sohn Pans — wenn Du willst und ich will schreiben. (28)
Die Briefe zeichnen nicht unbedingt ein neues Fichte-Bild — aber als Fan muss man das natürlich lesen. Auch wenn ich mit schlechtem Gewissen lese, weil es dem Autorwillen ausdrücklich widerspricht, denn der wollte diese Dokumente vernichtet haben (was Leonore Mau in Bezug auf seinen sonstigen schriftlichen Nachlass auch weitgehend befolgte, bei den Briefen (zumindest diesen) aber unterließ, so dass sie nach ihrem Tod jetzt sozusagen gegen beider willen doch öffentlich werden können und das Private der beiden Künstlerpersonen also der Öffentlichkeit einverleibt werden kann …) Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob sich — wie Herausgeber Peter Braun im Nachwort breit ausführt — daraus wirklich ein “Relief” im Zusammenspiel mit den Werken bildet. Und wie immer bin ich mir ziemlich unsicher, ob das den Werken (es geht ja vor allem um die unfertige “Geschichte der Empfindlichkeit”) wirklich gut tut (bzw. der Lektüre), wenn man sie mit den Briefen — und damit mit ihrem Autor — so eng verschränkt. Und ob es in irgend einer Weise notwendig ist, scheint mir auch zweifelhaft. Ja, man erkennt die autobiographische Grundierung mancher Jäcki-Züge und auch der Irma-Figur nach der Lektüre der Briefe noch einmal. Aber verleitet das Briefe-Lesen dann nicht doch dazu, aus Jäcki Hubert und aus Irm Leonore zu machen und damit wieder am Text der Werke vorbei zu lesen? Andererseits: ein wirklich neues Bild, eine unentdeckte Lesart der Glossen oder der Alten Welt scheint sich dann selbst für Braun doch nicht zu ergeben.
Ich will Freiheit, Freiheit — und dazu bedarfs Witzes und Lachens. (42)
Selbst Willi Winkler, durchaus enthusiastischer Fichteaner, befindet in der Süddeutschen Zeitung: “Diese Briefe, einmal muss es doch heraus, sind nämlich von sensationeller Belanglosigkeit” und schießt dann noch recht böse gegen die tatsächlich manchmal auffallenden Banalitäten des Kommentars (mein Lieblingskommentar: „Darmgeräusche: Darmgeräusche sind ein Ausdruck der Peristaltik von Magen und Darm und insofern Anzeichen für deren normale oder gestörte Tätigkeit.“ (167)) und das etwas hochtrabende Nachwort von Herausgeber Braun. Überhaupt macht das Drumherum, das ja eine ganze Menge Raum einnimmt, eher wenig Spaß. Das liegt auch an der eher unschönen, lieblose Gestaltung. Und den — wie man es bei Fichte und Fischer ja leider gewöhnt ist — vagen, ungenauen Editionsrichtlinien. Der Titel müsste eigentlich auch anders heißen, das Zitat geht nämlich noch ein Wort weiter und heißt dann: “Ich beiße dich zum Abschied ganz zart / wohin.” So steht es zumindest im entsprechenden Brief, war dem Verlag aber wohl zu heikel. Und das ist dann doch schade …
Aber für uns ist ja nur das Unvorsichtige das richtige. (141)
außerdem gelesen:
- T. E. Lawrence: Wüsten-Guerilla. Übersetzt von Florian Tremba. Herausgegeben von Reiner Niehoff. Berlin: blauwerke 2015 (= splitter 05/06). 98 Seiten. ISBN 9783945002056.
- Björn Kuhligk: Ich habe den Tag zerschnitten. Riga: hochroth 2013. 26 Seiten. ISBN 97839934838309.
- Christian Meierhofer: Georg Philipp Harsdörffer. Hannover: Wehrhahn 2014 (Meteore 15). 134 Seiten. ISBN 978–3‑86525–418‑4.
- Edit #66
- Mütze #12 & #13 (mit interessanten Gedichten von Kurt Aebli und Rainer René Mueller)
