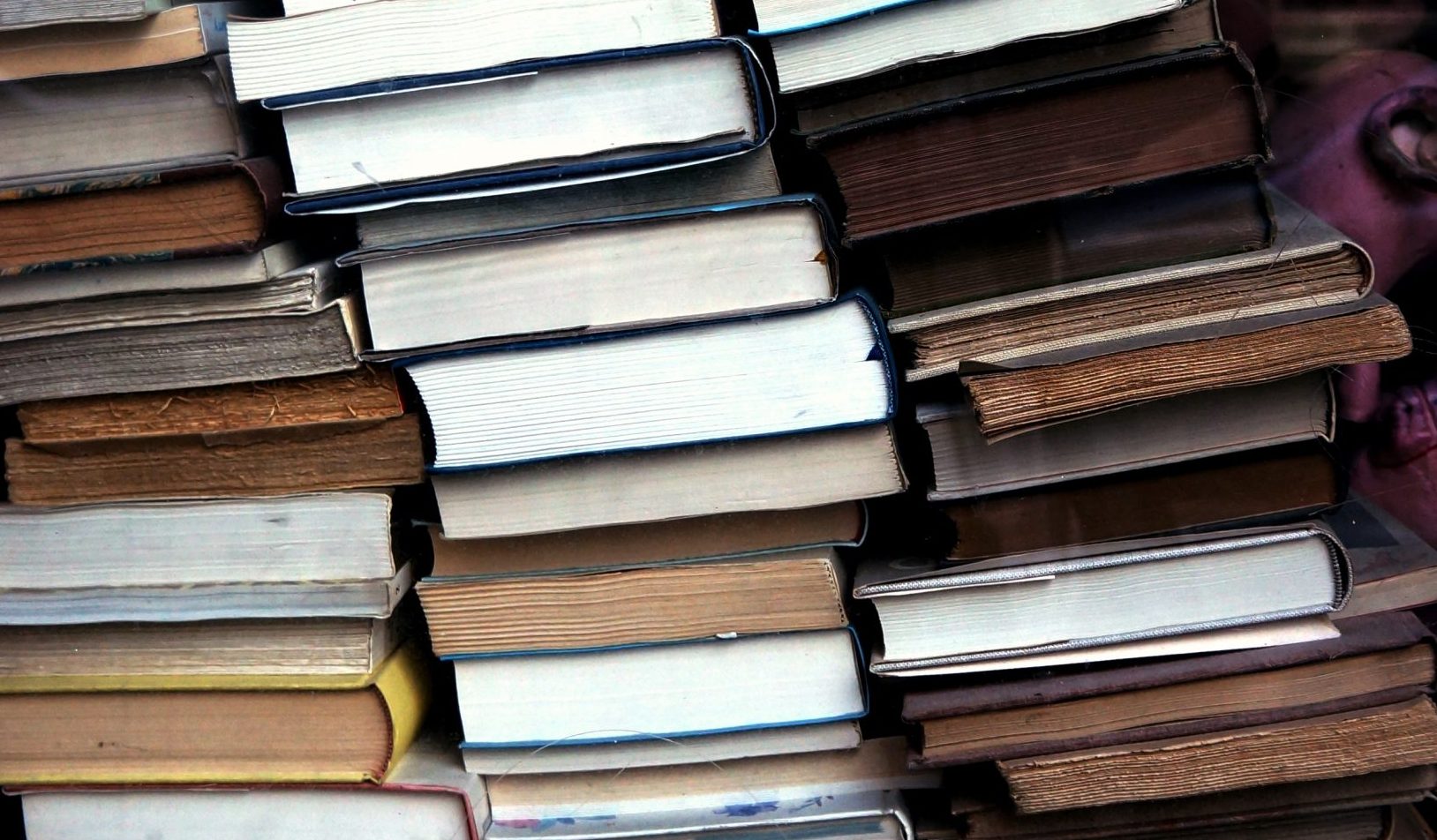Ich kann nicht sagen, dass ich von Romeo oder Julia wirklich begeistert gewesen wäre. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht so recht kapiert habe, was der Text eigentlich (sein) möchte. Dabei hat er unbestreitbar ausgezeichnete Momente und Seiten, neben einigen Längen. Einige der ausgezeichneten Momente finden auf der Ebene der Sprache statt: Es gibt funkelnde einzelne Sätze in einem Meer von stilistischem und gedanklichem Chaos. So habe ich mir das zunächst notiert — aber das stimmt so nicht ganz: chaotisch (also realistisch) erscheint der Text zunächst nur, er entwickelt dann aber schon seine Form. Die zumindest stellenweise hypertrophe Stilistik in der Übersteigerung auf allen Ebenen ist dann auch tatsächlich lustig.
Ich kann nicht sagen, dass ich von Romeo oder Julia wirklich begeistert gewesen wäre. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht so recht kapiert habe, was der Text eigentlich (sein) möchte. Dabei hat er unbestreitbar ausgezeichnete Momente und Seiten, neben einigen Längen. Einige der ausgezeichneten Momente finden auf der Ebene der Sprache statt: Es gibt funkelnde einzelne Sätze in einem Meer von stilistischem und gedanklichem Chaos. So habe ich mir das zunächst notiert — aber das stimmt so nicht ganz: chaotisch (also realistisch) erscheint der Text zunächst nur, er entwickelt dann aber schon seine Form. Die zumindest stellenweise hypertrophe Stilistik in der Übersteigerung auf allen Ebenen ist dann auch tatsächlich lustig.
Unermüdlich arbeiteten hinter den Dingen, an denen ich vorbeikam, die Grundmaschinen der Existenz, die seit Jahrtausenden mit Menschenleben gefüttert werden, und die Stadt stützte ihre taube und ornamentale Masse auf dieses unterirdische Magma von Lebensgier, Kampf, Wille, Lust und Bewegung. 227
Was wird in Romeo oder Julia erzählt? Das ist eben die Frage. Irgendwie geht es um einen Schriftsteller, Kurt Prinzhorn (über dessen literarische Werke nichts zu erfahren ist), der bei einem Hotelaufenthalt in Innsbruck von einer benutzten Badewanne und verschwundenen Schlüsseln etwas erschreckt wird. Ratlos bleibt er zurück und denkt immer wieder über die Rätselhaftigkeit des Geschehens nach, während das Autorenleben mit Stationen in Moskau und Madrid weitergeht. Dort nähert sich dann auch die antiklimaktische Auflösung, die in einem Nachspiel in Berlin noch einmal ausgebreitet wird: Der Erzähler wird von einer sehr viel früheren kurzzeitigen Freundin verfolgt und bedroht, die dann beim Versuch, zu ihm zu gelangen (um ihn zu töten), selbst stirbt … Trotz des Plots, der nach Krimi oder Thriller klingt, bleibt Romeo oder Julia bei einer unbeschwerten Rätselhaftigkeit, ein Spiel mit Spannungselementen, sexistischem und völkerpsychologischem Unsinn und anderen Peinlichkeiten. Immerhin sind der knappe Umfang und die eher kurzen Kapitel (übrigens genau 42 — wobei ich bei Falkner in diesem Fall keine Absicht unterstelle) sehr leserfreundlich. Durch die zumindest eingestreuten stilistischen Höhenflüge war das für mich eine durchaus unterhaltsame Lektüre, bei der ich keine Ahnung habe, was das eigentlich sein soll, was der Text eigentlich will. Weder die Krimi-Elemente noch die Popliteraturkomponente oder die massiven Intertextualitätssignale (die ich nicht alle in vernünftige Beziehung zum Text bringe, aber sicherlich habe ich auch eine Menge schlicht übersehen) formen sich bei meiner Lektüre zu einem Konzept: Ein schlüssiges Sinnkonstrukt kann ich nicht so recht erkennen, nicht lesen und leider auch nicht basteln.
Es war Sonntagvormittag, und es gab kaum Leute auf der Straße. Straßen auf den Leuten gab es erst recht nicht. es gab auch keine Busse, die man sich auf der Zunge hätte zergehen lassen können, oder Friseure, die aufgrund einer ungestümen Blümeranz der Ohnmacht nahe gewesen wären. Auch nicht die Heldenfriedhöfe, die in wilden und ausufernden Vorfrühlingsnächten von den Suchmaschinen auf die Bildschirme gezaubert werden, um mit ihren schneeweißen und christuslosen Kreuzen die Surfer in ihre leere Erde zu locken. Es gab nicht einmal die feuchte, warme Hand der katholischen Kirche oder das tröstliche Röcheln des Drachens, dem sein beliebtester Gegner, der heilige Georg, gerade die eiserne Lanze in den Rachen gestoßen hat. Es gab einfach wirklich nur das, was da war, was wir unmittelbar vor Augen hatten, und die Tatsache, dass ich in Kürze losmusste. 78
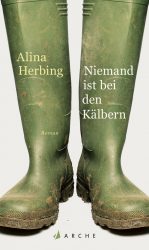 Das ist mal ein ziemlich trostloses Buch über eine junge Bäuerin aus Alternativlosigkeit, die auch in den angeblich so festen Werten und sozialen Netzen des Landlebens (der „Heimat“) keinen Halt findet, keinen Sinn für ihr Leben. Stattdessen herrscht überall Gewalt — gegen Dinge, Tiere und Menschen. Einerseits ist da also die Banalität des Landlebens, der Ödnis, der „Normalität“, dem nicht-besonderen, nicht-individuellen Leben. Andererseits brodelt es darunter so stark, dass auch die Oberfläche in Bewegung gerät und Risse bekommt. Natürlich gibt es die Schönheit des Landes, auch in der beschreibenden Sprache (die freilich nicht so recht zur eigentlichen Erzählhaltung passt und mit ihren angedeuteten pseudo-umgangssprachlichen Wendunge („nich“, “glaub ich”) auch viele schwache Seiten hat und nerven kann). Aber genauso natürlich gibt es auch die Verletzungen, die die Menschen sich gegenseitig und der “natürlichen” Umwelt gleichermaßen zufügen.
Das ist mal ein ziemlich trostloses Buch über eine junge Bäuerin aus Alternativlosigkeit, die auch in den angeblich so festen Werten und sozialen Netzen des Landlebens (der „Heimat“) keinen Halt findet, keinen Sinn für ihr Leben. Stattdessen herrscht überall Gewalt — gegen Dinge, Tiere und Menschen. Einerseits ist da also die Banalität des Landlebens, der Ödnis, der „Normalität“, dem nicht-besonderen, nicht-individuellen Leben. Andererseits brodelt es darunter so stark, dass auch die Oberfläche in Bewegung gerät und Risse bekommt. Natürlich gibt es die Schönheit des Landes, auch in der beschreibenden Sprache (die freilich nicht so recht zur eigentlichen Erzählhaltung passt und mit ihren angedeuteten pseudo-umgangssprachlichen Wendunge („nich“, “glaub ich”) auch viele schwache Seiten hat und nerven kann). Aber genauso natürlich gibt es auch die Verletzungen, die die Menschen sich gegenseitig und der “natürlichen” Umwelt gleichermaßen zufügen.
Die Absicht von Niemand ist bei den Kälbern ist schnell klar (schon mit dem Umschlag, sonst spätestens auf der ersten Seite, wenn das Rehkitz beim Mähen getötet wird): Heimat, v.a. aber das Landleben entzaubern — denn es ist auch nur eine Reihe von Banalitäten und Einsamkeiten (auch & gerade zu zweit) und suche nach Liebe, Nähe, Emotionen. Die Natur bleibt von all dem unbeteiligt und eigentlich unberührt. Mich nerven aber so Hauptfiguren wie diese Christin, die — obwohl vielleicht nicht direkt defätistisch — alles (!) einfach so hinnehmen, ohne Gefühlsregung, ohne Gestaltungswillen, ja fast ohne Willen überhaupt, denen alles nur passiert, die alles mit sich geschehen lassen. Dass da dann kein erfüllter Lebensentwurf herauskommt, ist abzusehen. Mir war das unter anderem deshalb zu einseitig, zu eindimensional.
Manchmal glaub ich, jedes Flugzeug, das ich sehe, existiert überhaupt nur, um mich daran zu erinnern, dass ich einer der unbedeutendsten Menschen der Welt bin. Wieso sollte ich sonst in diesem Moment auf einem halb abgemähten Feld stehen? Nicht mal in einer Nazi-Hochburg, nicht mal an der Ostsee oder auf der Seenplatte, nicht mal auf dem Todesstreifen, sondern kurz davor, daneben, irgendwo zwischen alldem. Genau da, wo es eigentlich nichts gibt außer Gras und Lehmboden und ein paar Plätze, die gut genug sind, um da Windräder hinzustellen. 11
 Das ist tatsächlich ein ziemlich lustiger Roman über Roland Barthes, die postmoderne Philosophie, Sprachwissenschaft und Psychologie in Frankreich, auch wenn der Text einige Längen hat. Vielleicht ist das aber wirklich nur für Leser lustig, die sich zumindest ein bisschen in der Geschichte der französischen Postmoderne, ihrem Personal und ihren Ideen (und deren Rezeption in den USA und Europa) auskennen. Und es ist auch ein etwas grotesker Humor, der so ziemlich alle Geistesheroen des 20. Jahrhunderts körperlich und seelisch beschädigt zurücklässt.
Das ist tatsächlich ein ziemlich lustiger Roman über Roland Barthes, die postmoderne Philosophie, Sprachwissenschaft und Psychologie in Frankreich, auch wenn der Text einige Längen hat. Vielleicht ist das aber wirklich nur für Leser lustig, die sich zumindest ein bisschen in der Geschichte der französischen Postmoderne, ihrem Personal und ihren Ideen (und deren Rezeption in den USA und Europa) auskennen. Und es ist auch ein etwas grotesker Humor, der so ziemlich alle Geistesheroen des 20. Jahrhunderts körperlich und seelisch beschädigt zurücklässt.
Ausgangspunkt der mehr als 500 Seiten, die aber schnell gelesen sind, ist der Tod des Strukturalisten und Semiotikers Roland Barthes, der im Februar 1980 bei einen Unfall überfahren wurde. Für die Ermittlungen, die schnell einerseits in das philosophisch geprägte Milieu der Postmoderne führen, andererseits voller Absurditäten und grotesker Geschehnisse sind, verpflichtet der etwas hemdsärmelige Kommissar einen Doktorand, der sich in diesem Gebiet gut auszukennen scheint. Ihre Ermittlungen führt das Duo dann in fünf Stationen von Paris über Bologna nach Ithaca/USA und zurück zu Umberto Eco (der einzige, der einigermaßen unversehrt davonkommt), womit die Reise, die Ermittlung und der Text das Netzwerk europäischen Denkens (mit seinen amerikanischen Satelliten der Ostküste) in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nachzeichnen. Das ist so etwas wie ein Pop-Philosophie-Thriller, der für mich doch recht zügig seinen Reiz verlor, weil das als Romantext eher banal und konventionell bleibt. Interessant sind höchstens die Metaebenen der Erzählung (die es reichlich gibt) und die Anachronismen (die auch gerne und mit Absicht verwendet werden), zumal die Theorie und ihr Personal immer mehr aus dem Blick geraten
Die im Titel verhießene siebte Sprachfunktion bleibt natürlich Leerstelle und wird nur in Andeutungen — als unwiderstehliche, politisch nutzbare Überzeugungskraft der Rede — konturiert. Dafür gibt es genügend andere Stationen, bei denen Binet sein Wissen der europäischen und amerikanischen Postmoderne großzügig ausbreiten kann.
Während er rückwärtsgeht, überlegt Simon: Angenommen, er wäre wirklich eine Romangestalt (eine Annahme, die weitere Nahrung erhält durch das Setting, die Masken, die mächtigen malerischen Gegenstände: in einem Roman, der sich nicht zu gut dafür wäre, alle Klischees zu bedienen, denkt er), welcher Gefahr wäre er im Ernst ausgesetzt? Ein Roman ist kein Traum: In einem Roman kann man umkommen. Hinwiederum kommt normalerweise die Hauptfigur nicht ums Leben, außer vielleicht gegen Ende der Handlung. / Aber wenn es das Ende der Handlung wäre, wie würde er das erfahren? Wie erfährt man, wann man auf der letzten Seite angekommen ist? / Und wenn er gar nicht die Hauptfigur wäre? Hält sich nicht jeder für den Helden seiner eigenen Existenz? 420
 Ein feines, kleines Büchlein. Mit “Interview” ist es viel zu prosaisch umschrieben, denn einerseits ist das ein vernünftiges Gespräch, andererseits aber auch so etwas wie ein Auskunftsbuch: Dieter Grimm gibt Auskunft über sich, sein Leben und sein Werk. Dabei lernt man auch als Nicht-Jurist eine Menge — zumindest ging es mir so: Viel spannendes zur Entwicklung von recht und Verfassung konnte ich hier lesen — spannend vor allem durch das Interesse Grimms an Nachbardisziplinen des Rechts, insbesondere der Soziologie. Deshalb tauchen dann auch ein paar nette Luhmann-Anekdoten auf. Außerdem gewinnt man als Leser auch ein bisschen Einblick in Verfahren, Organisation und Beratung am Bundesverfassungsgericht, an dem Grimm für 12 Jahre als Richter tätig war. Schön ist schon die nüchterne Schilderung der der nüchternen Wahl zum Richter — ein politischer Auswahlprozess, den Grimm für “erfreulich unprofessionell” (126) hält. Natürlich gewinnt das Buch nicht nur durch Grimms Einblick in grundlegende Wesensmerkmale des Rechts und der Jurisprudenz, sondern auch durch seine durchaus spannende Biographie mit ihren vielen Stationen — von Kassel über Frankfurt und Freiburg nach Paris und Harvard wieder zurück nach Frankfurt und Bielefeld, dann natürlich Karlsruhe und zum Schluss noch Berlin — also quasi die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland — Grimm ist 1937 geboren — in einem Leben kondensiert.
Ein feines, kleines Büchlein. Mit “Interview” ist es viel zu prosaisch umschrieben, denn einerseits ist das ein vernünftiges Gespräch, andererseits aber auch so etwas wie ein Auskunftsbuch: Dieter Grimm gibt Auskunft über sich, sein Leben und sein Werk. Dabei lernt man auch als Nicht-Jurist eine Menge — zumindest ging es mir so: Viel spannendes zur Entwicklung von recht und Verfassung konnte ich hier lesen — spannend vor allem durch das Interesse Grimms an Nachbardisziplinen des Rechts, insbesondere der Soziologie. Deshalb tauchen dann auch ein paar nette Luhmann-Anekdoten auf. Außerdem gewinnt man als Leser auch ein bisschen Einblick in Verfahren, Organisation und Beratung am Bundesverfassungsgericht, an dem Grimm für 12 Jahre als Richter tätig war. Schön ist schon die nüchterne Schilderung der der nüchternen Wahl zum Richter — ein politischer Auswahlprozess, den Grimm für “erfreulich unprofessionell” (126) hält. Natürlich gewinnt das Buch nicht nur durch Grimms Einblick in grundlegende Wesensmerkmale des Rechts und der Jurisprudenz, sondern auch durch seine durchaus spannende Biographie mit ihren vielen Stationen — von Kassel über Frankfurt und Freiburg nach Paris und Harvard wieder zurück nach Frankfurt und Bielefeld, dann natürlich Karlsruhe und zum Schluss noch Berlin — also quasi die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland — Grimm ist 1937 geboren — in einem Leben kondensiert.
Das Buch hat immerhin auch seine Seltsamkeiten — in einem solchen Text in zwei Stichwörtern in der Fußnote zu erklären, wer Konrad Adenauer war, hat schon seine komische Seite. Bei so manch anderem Namen war ich aber froh über zumindest die grobe Aufklärung, um wen es sich handelt. Die andere Seltsamkeit betrifft den Satz. Dabei hat jemand nämlich geschlampt, es kommen immer wieder Passagen vor, die ein Schriftgrad kleiner gesetzt wurden, ohne dass das inhaltlich motiviert zu sein scheint — offensichtlich ein unschöner Fehler, der bei einem renommierten und traditionsreichen Verlag wie Mohr Siebeck ziemlich peinlich ist.
Adorno verstand ich nicht. Streckenweise unterhielt ich mich einfach damit zu prüfen, ober er seine Schachtelsätze korrekt zu Ende brachte. Er tat es. 41
Zu diesem schönen, wenn auch recht kurzen Vergnügen habe ich vor einiger Zeit schon etwas gesondert geschrieben: klick.
außerdem gelesen:
- Dirk von Petersdorff: In der Bar zum Krokodil. Lieder und Songs als Gedichte. Göttingen: Wallstein 2017 (Kleine Schriften zur literarischen Ästhetik und Hermeneutik, 9). 113 Seiten. ISBN 978–3‑8353–3022‑1.
- Hans-Rudolf Vaget: “Wehvolles Erbe”. Richard Wagner in Deutschland. Hitler, Knappertsbusch, Mann. Frankfurt am Main: Fischer 2017. 560 Seiten. ISBN 9783103972443.