Verse stellen ihrem Sinn ein Bein oder ihrem Fuß einen Sinn.
—Franz Josef Czernin: Sätze (73)

Verse stellen ihrem Sinn ein Bein oder ihrem Fuß einen Sinn.
—Franz Josef Czernin: Sätze (73)
 Fünf Kapitel zwischen Wien und Berlin, in denen Lottmann seinen Protagonisten die Euphorie des Rauschgifts und (weniger stark ausgeprägt) den Absturz des Entzugs anhand der als überall verfügbare und überall genutzen Modedroge Kokain (der Titel macht ja kein Geheimnis daraus) erfahren lässt. Dabei steht aber nicht der Rausch im Mittelpunkt (und am Ziel des Drogenkonsums), sondern die “Nebeneffekte”: Das Abnehmen, das geänderte Sozialverhalten, die anders er- und ausgelebte Sexualität — und das Geld. Die durchaus komischen und amüsanten Schilderungen der Erlebnisse, die dem Helden auf dieser, nun ja, Irrfahrt begegnen, ergänzt Lottmann etwas motivationslos (und für den Text auch ausgeprochen folgenlos) sowie nicht sehr geschickt mit dem “Wissenschaftlichen Tagebuch” des Protagonisten, dessen Eintragungen ganz stereotyp mit “Liebes wissenschaftliches Tagebuch,” beginnen, die vom Erzähler brav zitiert werden und vor allem durch ihre unglaubwürdige Naivität auffallen. Ansonsten besticht der heterodiegetische Erzähler vor allem durch sein entspanntes, leicht distanziertes Plaudern, das mit Sympathie für seine Hauptfigur Stephan Braumer erzählt, dabei dessen Neugier und auch Befremden angesichts der „Perversionen“ der anderen teilend. Endlich Kokain ist aber nicht nur ein Drogenroman — das wäre Lottmann wohl zu wenig. Zugleich will der Text auch noch eine Kunstbetriebssatire sein. Das klappt so halbwegs, versandet aber in der netten Harmlosigkeit. Und auch eine Anti-Entwicklungsroman (allerdings mit versöhnlichem Happy-Ende soll das noch sein. Da aber überhaupt alles nett und flockig bleibt, nirgends hart (auch sprachlich nicht), klappt das, was über den unterhaltsamen Bericht der täppischen Unternehmungen Braumers hinausgeht, auch nur selten. Bartels fasst das in seiner Rezension ganz gut zuammen:
Fünf Kapitel zwischen Wien und Berlin, in denen Lottmann seinen Protagonisten die Euphorie des Rauschgifts und (weniger stark ausgeprägt) den Absturz des Entzugs anhand der als überall verfügbare und überall genutzen Modedroge Kokain (der Titel macht ja kein Geheimnis daraus) erfahren lässt. Dabei steht aber nicht der Rausch im Mittelpunkt (und am Ziel des Drogenkonsums), sondern die “Nebeneffekte”: Das Abnehmen, das geänderte Sozialverhalten, die anders er- und ausgelebte Sexualität — und das Geld. Die durchaus komischen und amüsanten Schilderungen der Erlebnisse, die dem Helden auf dieser, nun ja, Irrfahrt begegnen, ergänzt Lottmann etwas motivationslos (und für den Text auch ausgeprochen folgenlos) sowie nicht sehr geschickt mit dem “Wissenschaftlichen Tagebuch” des Protagonisten, dessen Eintragungen ganz stereotyp mit “Liebes wissenschaftliches Tagebuch,” beginnen, die vom Erzähler brav zitiert werden und vor allem durch ihre unglaubwürdige Naivität auffallen. Ansonsten besticht der heterodiegetische Erzähler vor allem durch sein entspanntes, leicht distanziertes Plaudern, das mit Sympathie für seine Hauptfigur Stephan Braumer erzählt, dabei dessen Neugier und auch Befremden angesichts der „Perversionen“ der anderen teilend. Endlich Kokain ist aber nicht nur ein Drogenroman — das wäre Lottmann wohl zu wenig. Zugleich will der Text auch noch eine Kunstbetriebssatire sein. Das klappt so halbwegs, versandet aber in der netten Harmlosigkeit. Und auch eine Anti-Entwicklungsroman (allerdings mit versöhnlichem Happy-Ende soll das noch sein. Da aber überhaupt alles nett und flockig bleibt, nirgends hart (auch sprachlich nicht), klappt das, was über den unterhaltsamen Bericht der täppischen Unternehmungen Braumers hinausgeht, auch nur selten. Bartels fasst das in seiner Rezension ganz gut zuammen:
Am besten ist es, “Endlich Kokain” wie im Rausch in einem Zug zu lesen, dann ist der Spaß am allergrößten. Sonst könnte man leicht auf den Gedanken kommen, schon bessere Drogenromane und Kunstbetriebssatiren gelesen zu haben.
 Einen postmodernen Schelmenroman verheißt der Umschlagtext. Den bekommt man allerdings nicht. Lesen kann man So kalt und schön am besten als Versuch, einen solchen zu schreiben — ein Versuch, der nicht so richtig glückt. Denn auf beiden Ebenen bleibt Dittmar vor dem Ziel stehen: Weder ist das ein gelungener Schelmenroman — die Elemente sind da, der Witz fehlt … -, noch kann der postmoderne Aspekt überzeugen. Der erschöpft sich nämlich im Auf- und Vorführen von möglichst vielen Namen, die im Kulturleben (vor allem im literarischen Teil) der Bundesrepublik eine Rolle spielten. Das geschieht aber regelmäßig ohne besondere Motivation, so dass es leere Geste bleibt. Typisch für diese Halbherzigkeit, die viel von dem Text durchzieht, ist die Tatsache, dass die Herausgeberfiktion den Verlag überforderte oder der sie nicht mitmachen wollte und sie deshalb gleich auf dem Titelblatt “zerstört” — dann kann man sich so etwas auch gleich sparen. Ähnliches gilt für die “Anmerkungen”, die bloß belanglos sind und willkürlich ein paar Fakten im Wikipedia-Stil hinzufügen.
Einen postmodernen Schelmenroman verheißt der Umschlagtext. Den bekommt man allerdings nicht. Lesen kann man So kalt und schön am besten als Versuch, einen solchen zu schreiben — ein Versuch, der nicht so richtig glückt. Denn auf beiden Ebenen bleibt Dittmar vor dem Ziel stehen: Weder ist das ein gelungener Schelmenroman — die Elemente sind da, der Witz fehlt … -, noch kann der postmoderne Aspekt überzeugen. Der erschöpft sich nämlich im Auf- und Vorführen von möglichst vielen Namen, die im Kulturleben (vor allem im literarischen Teil) der Bundesrepublik eine Rolle spielten. Das geschieht aber regelmäßig ohne besondere Motivation, so dass es leere Geste bleibt. Typisch für diese Halbherzigkeit, die viel von dem Text durchzieht, ist die Tatsache, dass die Herausgeberfiktion den Verlag überforderte oder der sie nicht mitmachen wollte und sie deshalb gleich auf dem Titelblatt “zerstört” — dann kann man sich so etwas auch gleich sparen. Ähnliches gilt für die “Anmerkungen”, die bloß belanglos sind und willkürlich ein paar Fakten im Wikipedia-Stil hinzufügen.
Der Erzähler ist ein penetrant dozierender Erzähler, der mehr erklärt (und vorführt, gerade an Büchern und Gestalten und Autoren) als er erzählt: “Und Andrea versuchte, sich das vorzustellen, aber es ging nicht.” (67) heißt es einmal — so ähnlich geht es dem Leser (d.h. mir) auch.
 Dieses schmale Reclam-Bändchen ist wunderbare lustige und lustvolle Lektüre für zwischendurch: Kuriosa aus der Litaturgeschichte des Mittelhochdeutschen und vor allem der Frühen Neuzeit. Brunner schreibt im Nachwort:
Dieses schmale Reclam-Bändchen ist wunderbare lustige und lustvolle Lektüre für zwischendurch: Kuriosa aus der Litaturgeschichte des Mittelhochdeutschen und vor allem der Frühen Neuzeit. Brunner schreibt im Nachwort:
Auch im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit gab es Menschen, die gern und entspannt gelacht haben, weder dachten sie unausgesetzt an das Jenseits, noch an den Sinn ihrer ständischen Existenz, noch an Rebellion und Aufrühertum. Die Texte, die ihnen gefallen haben, können durchaus auch uns heute noch erfreuen. (163)
In der Tat, die Dichtungen über Tiere, Unmöglichkeiten und verkehrte Welten sind erfreulich, im wahrsten Sinne des Wortes. “Das Schlauraffen Landt” von Hans Sachs ist wohl der bekannteste Text dieser Sammlung. Sehr schön aber auch der “Finkenritter” in der Tradition des Ritterromans und mit Verwandschaften zum Schelmenroman (Christian Reuter könnte sich hier durchaus bedient haben, denkt man beim Lesen manchmal, zum Beispiel bei der Schilderung der Geburt, die doch einige Ähnlichkeiten zum Schelmuffsky aufweist). Ansonsten: Viel Umkehrung des Sinns, ohne dass immer und unbedingt neuer Sinn daraus wird und auch nicht werden soll — also Un-Sinn im wahrsten Sinn des Wortes. Die Mittel sind zum Beispiel die verkehrte Sprachwelt, in der konsequent Subjekt und Objekt der Verse vertauscht werden. Oder einfach Unmöglichkeiten der Welt, in denen immer wieder der Triumph der Schwachen über Starke, der Gejagten über Jäger hervorblitzt. Sprachlich spielen natürlich auch Mittel der Verkehrung wie die contradictio in adiecto, das Paradoxon oder der ad absurdum getriebene Reimzwang eine große Rolle.
Ein Beispiel aus dem anonymen “Puch von den Wachteln”, ca. 1380:
geflogen kam ain regenwurm,
der hub den aller grösten sturm
mit ainem igel, der waz plos
herr dietrich von pern schoz
durch ain alten enuen wagen,
herr hildeprant durchn kragen,
herr Ekk durch den schüzzelkreben -
Chriemhilt verloz da ir leben,
da plut gen mainz ran.
herr vasolt kaum entran,
des leibs er sich verwak.
sibentzehen wahteln in den sak!
Sie musste durchsetzen, dass das ein Roman war und kein Buch und dass es richtig war, dass es Romane gab, und dass es um die Wahrheit ging. Um die vielen Möglichkeiten davon. (313)
 Streeruwitz schreibt weiter an ihrem Projekt zu Wahrheit und richtigen Leben, zum Verhältnis der Geschlechter, und, hier sehr deutlich, zum Problem der Ausbeutung. Im Gegensatz zu so manchen Rezensionen geht es in Nachkommen. gar nicht so sehr um den Literaturbetrieb — das ist kein Schlüsselroman. Der Betrieb um die Ware Buch, gemacht aus Romanen und anderen Texten (der Unterschied ist schon entscheidend, für Streeruwitz und ihre Protagonistin Nelia Fehn), ist eigentlich nur das Setting, der Rahmen, vor/in dem sich das Entscheidende abspielt.
Streeruwitz schreibt weiter an ihrem Projekt zu Wahrheit und richtigen Leben, zum Verhältnis der Geschlechter, und, hier sehr deutlich, zum Problem der Ausbeutung. Im Gegensatz zu so manchen Rezensionen geht es in Nachkommen. gar nicht so sehr um den Literaturbetrieb — das ist kein Schlüsselroman. Der Betrieb um die Ware Buch, gemacht aus Romanen und anderen Texten (der Unterschied ist schon entscheidend, für Streeruwitz und ihre Protagonistin Nelia Fehn), ist eigentlich nur das Setting, der Rahmen, vor/in dem sich das Entscheidende abspielt.
Das Entscheidende, um dem es in Nachkommen. geht, ist in meiner Lesart auch nicht das, was der Klappentext verheißt, nämlich “ein Roman über die Ordnung der Generationen”. Eigentlich — und ich finde das so deutlich, dass es schon fast übertrieben ist ist Nachkommen. ein Roman über Ausbeutung. Es geht darum zu zeigen, wie eine junge Frau (das Geschlecht ist nicht unwichtig!) das kapitalistische “Funktionieren” (ein-)übt, erkennt und — an sich, ihren eigenen Handlungen und denen anderer Menschen wie dem schmierigen Verleger, den Mäzenen, den Kritikerinnen etc — reflektiert und kritisiert. Wobei “Kritik” vielleicht schon zu viel verspricht, nämlich die Idee einer Alternative, einer verheißungsvollen Idee oder so. Darum geht es aber nicht, das weiß Nelia Fehn (die eigentlich Cornelia heißt) auch. Es geht aber darum, erst einmal zu zeigen, wie die An-/Einpassung in ein (übermächtiges) ökonomisches System funktioniert und was das für Folgen für das Individuum hat, wenn dieses System (nur) nach ökonomischen Kriterien funktioniert und nicht ein sinnhaftes, menschenfreundliches ist. Die Handlung — die Buchpreiszeremonie, die Frankfurter Buchmesse, die Interviews, die Trauer um die Mutter, die Begegnung mit dem absenten Vater — zeigt also die Ausbeutung auf verschiedenen Ebenen, als Selbst-Ausbeutung, als Ausbeutung durch den Verlag, durch die Medien, durch die Familie, aber auch die Ausbeutung anderer (etwa in Form billiger Abeitskräfte, hier v.a. anhand der Textilproduktion in Fernost, der Krise in Griechenland etc.): Ausbeutung ist sozusagen ein omnipräsentes Motiv im Text. Das funktioniert gerade deshalb so gut, weil der Roman eben keinen Ausweg zeigen will und kann: Er will das Problem bewusst machen und nicht einfache Lösungen propagieren. Die Absurdität und Komplexität und Unentrinnbarkeit der Schlechtigkeit der Welt, die sich auch in der Generationenungerechtigkeit spiegelt (nicht nur als ein Machtproblem im direkten Verhältnis, sondern grundsätzlich!) kann der Text aufzeigen. Aber ein Schlüsselroman des Literaturbetriebs ist das natürlich nicht — höchest so, wie die Buddenbrooks ein Schlüsselroman des Getreidehandels sind. Es geht nicht um dem Literaturbetrieb. Literatur ist unwichtig (geworden) — gerade das erfährt und bemerkt und zeigt die Protagonistin ja immer wieder: die Leere, die nur noch Betrieb und nicht mehr Literatur ist. Vor allem geht es in Nachkommen. aber um anderes: Frauen (und Männer) und ihre Rollen, Generationen, und, ganz wichtig, das Funktionieren in der kapitalistisch organisierten und durchdrungenen Gesellschaft als ein Funktionieren (der Menschen bzw. ihrer jeweiligen derzeitigen Rollen) im kapitalistischen Sinne, das trotz Krise die Ver-Wertung, also: die Ausnutzung nicht behindert. Oder anders gesagt: es geht darum, die totale Durchdringung der kapitalistischen Normen in der Gesellschaft mit all ihren Bereichen (wie etwa der Kunst) zu zeigen. Und das in der von Streeruwitz gewohnten präzisen, manchmal harten, immer faszinierenden Sprache.
Der Roman, so ist meine Erfahrung, gewinnt ungeheuer, wenn man dazu sich (noch einmal) die Poetik-Vorlesungen der Autorin zu Gemüte führt, die Fischer gerade noch einmal zusammen miteinem her schwachen Interview herausgegeben hat — da steht eigentlich schon alles drin, was man zur Ästhetik und den literarischen Zielen von Streeruwitz wissen muss.
Großartig. Wie eigentlich alles von Marlene Streeruwitz.
Warum wollte sie ein gutes Ergebnis sein. Überhaupt. Warum wollte sie schön ausschauen. Es ging doch darum, dass es sie gegeben hatte. Schon immer. Und lange bevor sie so groß und dünn geworden war. Sie war schon immer da gewesen, und es hätte gleichgültig sein sollen, wie sie aussah. Überhaupt. Sie war ja erst groß und dünn geworden, nachdem die Mami. Es wäre schön gewesen. Schöner. Viel schöner. Es wäre überhaupt nicht zu vergleichen gewesen. Sie hätte sich gewünscht, die Mami. Ihre Muter. Sie könnte sie sehen. Könnte etwas sagen. Dazu, wie sie aussah. Nur sehen. Sie anschauen. Es wäre schon genug gewesen. Es wäre das Schönste gewesen. Und selbst Marios verstand das nicht. Dass das so wichtig gewesen wäre. Aber Marios wollte, dass er das Wichtigste für sie war. Und sie wollte ja auch, dass Marios das wollte, und sie hatten bald aufgehört, darüber zu reden. Das war alles so weit innen. Das behielt sie da. Und warum fürchtete sie sich vor dem Treffen. Warum hatte sie dieses Chaos im Bauch. Fürchtete sie sich vor diesem Mann. Dieser Mann. Er war sinnlos. Er war mehr als sinnlos. Er war nicht einmal ein Ersatz. (158)
 700 Seiten für 16 Jahre Familiengeschichte — kurz fassen ist offenbar nicht die Stärke von Meinhardt. Brüder und Schwestern will ein breit erzähltes Panorama einer “Jahrhundertfamilie” sein (diesen Anspruch merkt man auf fast jeder Seite), die mit Rückblenden bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück reicht, vor allem aber die “Endphase” der DDR im Blick hat. Dabei, das ist schon ein erstes Problem, zerfällt die Familiengeschichte aber in seriell erzählte Einzelgeschichten: von Willy Werchow, dem Drucker und Betriebsleiter, der sich durch Kompromisse immer mehr der Partei- und Staatslinie annähert und kompromittiert, seiner Söhne Erik und vor allem Matti, der sozusagen aussteigt und “bloß” Binnenschiffer wird, dafür aber einen Roman schreibt (der hier auch mitgeteilt wird), den seine ehemalige Jugendliebe, die inzwischen als Lektorin in der BRD arbeitet, im “Westend-Verlag” (soll wohl Suhrkamp sein?) veröffentlicht, und Britta, die bei einem privaten Zirkus landet und dort mit einer neuartigen Akrobatiknummer Furore macht. Das alles ist umständlich und weit ausholend erzählt, ohne dass mir die Notwendigkeit dafür klar würde. Vor allem ist es im Detail manchmal — trotz der Recherchen und dem Bemühen um historische Authentizität — eher schwach und nachlässig, wirkt oft ungenau (zum Beispiel in der zeitlichen Fixierung). Eine Tendenz ins Allgemeine, zum Ausweichen ins irgendwie geartete “Über-Zeitliche” macht sich öfters unangehm bemerkbar. Dabei kann Meinhardt durchaus erzählen und beschreiben, detailliert und voller Faszination für den eigenen Stoff. Genauigkeit und Witz stecken da durchaus drin — aber eingebettet in große Längen und dürre Strecken. Denn andererseits verliert er sich immer wieder zu sehr im Detail. Es gibt einfach zu viel davon — und dabei wird nicht klar, warum (und wofür) das eigentlich alles notwendig sein soll, wo der Text hinwill (über die bloße Beschreibung hinaus). „– wird fortgesetzt –“ steht auf der letzten Seite: soll das alles denn immer noch nicht genug gewesen sein?
700 Seiten für 16 Jahre Familiengeschichte — kurz fassen ist offenbar nicht die Stärke von Meinhardt. Brüder und Schwestern will ein breit erzähltes Panorama einer “Jahrhundertfamilie” sein (diesen Anspruch merkt man auf fast jeder Seite), die mit Rückblenden bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück reicht, vor allem aber die “Endphase” der DDR im Blick hat. Dabei, das ist schon ein erstes Problem, zerfällt die Familiengeschichte aber in seriell erzählte Einzelgeschichten: von Willy Werchow, dem Drucker und Betriebsleiter, der sich durch Kompromisse immer mehr der Partei- und Staatslinie annähert und kompromittiert, seiner Söhne Erik und vor allem Matti, der sozusagen aussteigt und “bloß” Binnenschiffer wird, dafür aber einen Roman schreibt (der hier auch mitgeteilt wird), den seine ehemalige Jugendliebe, die inzwischen als Lektorin in der BRD arbeitet, im “Westend-Verlag” (soll wohl Suhrkamp sein?) veröffentlicht, und Britta, die bei einem privaten Zirkus landet und dort mit einer neuartigen Akrobatiknummer Furore macht. Das alles ist umständlich und weit ausholend erzählt, ohne dass mir die Notwendigkeit dafür klar würde. Vor allem ist es im Detail manchmal — trotz der Recherchen und dem Bemühen um historische Authentizität — eher schwach und nachlässig, wirkt oft ungenau (zum Beispiel in der zeitlichen Fixierung). Eine Tendenz ins Allgemeine, zum Ausweichen ins irgendwie geartete “Über-Zeitliche” macht sich öfters unangehm bemerkbar. Dabei kann Meinhardt durchaus erzählen und beschreiben, detailliert und voller Faszination für den eigenen Stoff. Genauigkeit und Witz stecken da durchaus drin — aber eingebettet in große Längen und dürre Strecken. Denn andererseits verliert er sich immer wieder zu sehr im Detail. Es gibt einfach zu viel davon — und dabei wird nicht klar, warum (und wofür) das eigentlich alles notwendig sein soll, wo der Text hinwill (über die bloße Beschreibung hinaus). „– wird fortgesetzt –“ steht auf der letzten Seite: soll das alles denn immer noch nicht genug gewesen sein?
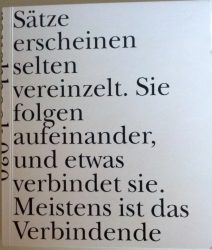 Da hat roughbooks mir wieder etwas beschert. Einerseits ist das faszinierend ohne Ende, kann man sich in diesen “Sätzen” wunderbar verlieren. Andererseits kann man aber auch aus dem Kopfschütteln kaum noch heraus kommen … — ein typisches roughbook also, in gewisser Hinsicht. Hans-Jost Frey und Franz Josef Czernin spielen sich hier gegenseitig Sätze zu — der jeweils andere muss darauf reagieren, mit Sätzen, die Wörter des Ausgangssatzes enthalten. Und Sätze sind hier ganz buchstäblich zu verstehen, es geht fast nur um einzelne Sätze. Und es sind “Sätze”, also Setzungen. Die sind oft axiomatisch, spielen immer wieder mit der Sprache, mit der Oberfläche und ihren Bedeutungen, häufen (scheinbare) Paradoxien, schmeißen mit Zitaten und Allusionen und Verfremdungen berühmter Aussagen berühmter Männer (Kant, Hegel, Nietzsche, Lacan, Freud, Kafka und so weiter) nur so um sich. Manchmal verselbständigt sich das, dann sind die “Regeln” auch nicht mehr so wichtig. Manchmal läuft sich das auch ein bisschen tot. Zumindest empfand ich das beim ersten Lesen so. Vermutlich würde eine wiederholte Lektüre ein ganz anderes Ergebnis zeigen, da wären vermeintliche Dürrestrecken dann vermutlich reich an wunder- und wertvollen Sätzen. Davon gibt es aber immer schon genug, auch nach dem ersten Lesen finden sich unzählige Anstreichungen in meinem Exemplar. Wieder ein Buch also, das mit einmaligem Lesen nicht ansatzweise abgetan ist …
Da hat roughbooks mir wieder etwas beschert. Einerseits ist das faszinierend ohne Ende, kann man sich in diesen “Sätzen” wunderbar verlieren. Andererseits kann man aber auch aus dem Kopfschütteln kaum noch heraus kommen … — ein typisches roughbook also, in gewisser Hinsicht. Hans-Jost Frey und Franz Josef Czernin spielen sich hier gegenseitig Sätze zu — der jeweils andere muss darauf reagieren, mit Sätzen, die Wörter des Ausgangssatzes enthalten. Und Sätze sind hier ganz buchstäblich zu verstehen, es geht fast nur um einzelne Sätze. Und es sind “Sätze”, also Setzungen. Die sind oft axiomatisch, spielen immer wieder mit der Sprache, mit der Oberfläche und ihren Bedeutungen, häufen (scheinbare) Paradoxien, schmeißen mit Zitaten und Allusionen und Verfremdungen berühmter Aussagen berühmter Männer (Kant, Hegel, Nietzsche, Lacan, Freud, Kafka und so weiter) nur so um sich. Manchmal verselbständigt sich das, dann sind die “Regeln” auch nicht mehr so wichtig. Manchmal läuft sich das auch ein bisschen tot. Zumindest empfand ich das beim ersten Lesen so. Vermutlich würde eine wiederholte Lektüre ein ganz anderes Ergebnis zeigen, da wären vermeintliche Dürrestrecken dann vermutlich reich an wunder- und wertvollen Sätzen. Davon gibt es aber immer schon genug, auch nach dem ersten Lesen finden sich unzählige Anstreichungen in meinem Exemplar. Wieder ein Buch also, das mit einmaligem Lesen nicht ansatzweise abgetan ist …
Zu diesen beiden Anthologien mit Lyrik aus den Jahren 1914–1918, dem Weltkrieg beziehungsweise seinem Umfeld in Deutschland, habe ich kürzlich schon ein paar Sätze geschrieben. Jedenfalls auch lohnende Lektüre — und gar nicht so schwer oder lang …
 Und zum Schluss noch ein feines Buch aus dem vorzüglichen Verbrecher-Verlag: Eine Tonne für Frau Schulz ist ein ausgezeichneter, präzise beobachtender und beschreibender Roman voller Witz und Esprit. Sicher, Gattungs- oder gar Literaturgeschichte wird der nicht schreiben. Aber es ist vorzügliche, niveauvolle Unterhaltung.
Und zum Schluss noch ein feines Buch aus dem vorzüglichen Verbrecher-Verlag: Eine Tonne für Frau Schulz ist ein ausgezeichneter, präzise beobachtender und beschreibender Roman voller Witz und Esprit. Sicher, Gattungs- oder gar Literaturgeschichte wird der nicht schreiben. Aber es ist vorzügliche, niveauvolle Unterhaltung.
Neben dem schön trockenen, präzisen und unaufdringlichen Humor der Erzählering hat mir auch die Gewöhnlichkeit des Settings und der Personen gut gefallen. Das sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen und ganze normalen Gedanken. Dabei wird das nicht anklagend oder vorführend erzählt, sondern sehr sympathisch. Das Leben an sich reicht schon, ist schön und erfüllend genug, da braucht es keine Besonderheiten, vielleicht auch keinen Ehrgeiz nach Individualität oder Besonderheit: Das Sein reicht schon, kann auch schön sein und glücklich machen (wenn man sich damit bescheidet, wie die Erzählerin). Die titelgebende Frau Scholz, eine alte Dame, mit der sich die Erzählerin, die mit ihrer Familie (Vater, Mutter, Sohn, Tochter — ganz normal eben …) im gleichen heruntergekommenen Berliner Mietshaus wohnt, anfreundet, verschafft sich dann aber doch noch eine Besonderheit, in dem sie sich einen Sohn erfindet, der Fluchthelfer an bzw. unter der Berliner Mauer war — offensichtlich eine Lüge, auch wenn das nie ganz eindeutig geklärt wird. Unter anderem, weil sie vor dem entscheidenden Interview mit der seltsam (für die Ich-Erzählerin) zielstrebigen Tochter einfach so stirbt … Den Freundinnen und Freunden guter, niveauvoller Unterhaltung jedenfalls wärmstens empfohlen.
Mir fehlen zwar oft eigene Worte, so viel verschwindet, wird absorbiert und zu häufig benutzt, und für vieles in mir drin habe ich überhaupt keine Wörter, noch nie gehabt, aber »Lebensqualität«, das gehört nicht zu mir. Ich will nur in der Küche sitzen und rauchen und weigere mich, dabei ein Lebensgefühl zu entwickeln. Ich will keinen Lebensstandard, keine Lebenslust, keinen Lebenstraum, keine Lebensphilosophie. (39)
außerdem:
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén