 Ein durchaus feiner Lyrikband, der mir mit seinen oft sehr lakonischen, auf brutale Kürze zusammengedampften Gedichten einige Lesefreude bereitete. Fues beschreibt vor allem die Dinghaftigkeit der Welt und ihre Erscheinungen, der Gegenstände und Zustände, Dinge und Geschehen. Sein bevorzugtes Mittel ist es, Beobachtungen oder Tatsachen einfach unvermittelt aufeinanderprallen zu lassen. Das wird auch sprachlich immer wieder deutlich: Fues bevorzugt Kontraste, das schwarz-weiß, den Vorder- und Hintergrund, jetzt und früher, unten oder oben und so weite. Die werden oft direkt gegenübergestellt, ohne Vermittlung, ohne ein Zwischen. Denn genau um dieses “Zwischen” geht es, um den Raum, der von den Begriffen so eröffnet wird. Dazu passen auch die Vertauschungen, gerade der Kontrastpaare:
Ein durchaus feiner Lyrikband, der mir mit seinen oft sehr lakonischen, auf brutale Kürze zusammengedampften Gedichten einige Lesefreude bereitete. Fues beschreibt vor allem die Dinghaftigkeit der Welt und ihre Erscheinungen, der Gegenstände und Zustände, Dinge und Geschehen. Sein bevorzugtes Mittel ist es, Beobachtungen oder Tatsachen einfach unvermittelt aufeinanderprallen zu lassen. Das wird auch sprachlich immer wieder deutlich: Fues bevorzugt Kontraste, das schwarz-weiß, den Vorder- und Hintergrund, jetzt und früher, unten oder oben und so weite. Die werden oft direkt gegenübergestellt, ohne Vermittlung, ohne ein Zwischen. Denn genau um dieses “Zwischen” geht es, um den Raum, der von den Begriffen so eröffnet wird. Dazu passen auch die Vertauschungen, gerade der Kontrastpaare:
Ein Baum wie
eine Antenne.
Eine Antenne
wie ein Baum.
Demnächst
botschaften Bäume
blühen Antennen. (44)
Manchmal sind Sinn und Sprache der kurzen Gedichte dermaßen verknappt und reduziert, dass nur noch Rätsel bleiben — Rätsel, die ein leeres Gerüst der Sprache zeigen, aus dem der Sinn ausgetrieben wurde ((z.b. 32). Dabei treibt ihn neben dieser Arbeit an der Sprache, die zwar reduziert, aber auch sehr konzentriert wird, gerade die Frage der Kausalität oder nur der Korrespondenz, der zeitlichen/räumlichen (sprachlichen) Folge besonders um. Der Titel, das “Zwischen”, das ist auch in seiner Sprache das Spannende: Das da-/in-/-/zwischen in der Abfolge, der Kausalität, der Entwicklung, der Korrelation (oder auch nicht, der nur so scheinenden …). Auf die Strichzeichnungen von Thitz hätte ich gut verzichten können — für mich sind das bloße — oft genug schlechte, weil banale — Illustrationen des im Gedicht vorkommenden, dabei allerdings sehr oberflächlich.
 Den Trafikant habe ich ja mit großem Vergnügen und Gewinn gelesen. Deswegen hat mich Ein ganzes Leben ziemlich enttäuscht. Meine Lektürenotizen sind sparsam: reichlich lahm fand ich das während des Lesen, auch erzählerisch einfach langweilig und charakterlos. Der Text beginnt etwas wie Stifter (auch sachen wie der am Beginn und Ende auftauchende Hörnerhannes und die sagenhafte “Kalte Frau” weisen auf die Verwandschaft hin), dann kommt noch ein bisschen Wimscheider und eine gehörige Portion Franz Innerhofer dazu. Seethaler erzählt ein Leben (aber ist das in irgend einer Hinsicht ein ganzes? Da sind viele Lücken …) eines Mannes, der als Waise in ein österreichisches Gebirgstal kommt und dort — mit Ausnahme des Zweiten Weltkrieges — und einem späten, versickernden Ausbruchsversuch nicht herauskommt. Dafür arbeitet er nach seinem Beginn als landwirtschaftlicher Tagelöhner am Einzug des Fortschritts in das Tal in Form von Seilbahnen mit — eines Fortschrittes, der aber mindestens so unmenschlich ist wie das harte Leben zuvor. Das ist tatsächlich so klischeehaft und einfallslos, wie das hier klingt … Ich verstehe ehrlich gesagt die Begeisterung der Rezensenten nicht so ganz — das ist mir alles zu banal und zu behäbig erzählt.
Den Trafikant habe ich ja mit großem Vergnügen und Gewinn gelesen. Deswegen hat mich Ein ganzes Leben ziemlich enttäuscht. Meine Lektürenotizen sind sparsam: reichlich lahm fand ich das während des Lesen, auch erzählerisch einfach langweilig und charakterlos. Der Text beginnt etwas wie Stifter (auch sachen wie der am Beginn und Ende auftauchende Hörnerhannes und die sagenhafte “Kalte Frau” weisen auf die Verwandschaft hin), dann kommt noch ein bisschen Wimscheider und eine gehörige Portion Franz Innerhofer dazu. Seethaler erzählt ein Leben (aber ist das in irgend einer Hinsicht ein ganzes? Da sind viele Lücken …) eines Mannes, der als Waise in ein österreichisches Gebirgstal kommt und dort — mit Ausnahme des Zweiten Weltkrieges — und einem späten, versickernden Ausbruchsversuch nicht herauskommt. Dafür arbeitet er nach seinem Beginn als landwirtschaftlicher Tagelöhner am Einzug des Fortschritts in das Tal in Form von Seilbahnen mit — eines Fortschrittes, der aber mindestens so unmenschlich ist wie das harte Leben zuvor. Das ist tatsächlich so klischeehaft und einfallslos, wie das hier klingt … Ich verstehe ehrlich gesagt die Begeisterung der Rezensenten nicht so ganz — das ist mir alles zu banal und zu behäbig erzählt.
 Eine Art Streitgespräch zwischen Wotan und Brünhilde am Schluss des “Ring des Nibelungen”. Aber Gespräch ist fast schon zu viel gesagt: Die beiden Stimmen monologisierend mehr anklagend abwechselnd auf einander zu oder gegen einander. Es geht um alles, nämlich die gesamte Welt und ihre Geschichte. Dabei kommen beide immerzu von einem zum anderen, vom Hölzchen aufs Stöckchen — manchmal ist es der Klang bestimmter Wörter, der den Anschluss sichert, manchmal ein thematischer Zusammenhang, manchmal ein systematischer oder ein personaler. Das macht das Lesen so anstrengend und schwierig: Wie eigentlich immer bei Jelinek ist auch Rein Gold total überfrachtet. Man muss sich selbst eine Schneise durch diese Textlandschaft schlagen, seinen Weg suchen und dabei so manchen Irrgang nicht in Kauf nehmen. Dafür bekommt man eine Anklage der Macht, des auf (unbedienten) Schulden beruhenden Kapitalismus, der Ausbeutung überhaupt, dem Verhältnist von Männern und Frauen und dem von Töchtern und Väter im besonderen. Das ist oft witzig, treffend und genau, manchmal aber auch absurd und manisch, wie hier alles — also wirklich Gott und die Welt, schließlich ist Wotan ja nicht irgendwer, wie er gerne betont, und Brünhilde natürlich auch nicht — durch den Textwolf gedreht wird.
Eine Art Streitgespräch zwischen Wotan und Brünhilde am Schluss des “Ring des Nibelungen”. Aber Gespräch ist fast schon zu viel gesagt: Die beiden Stimmen monologisierend mehr anklagend abwechselnd auf einander zu oder gegen einander. Es geht um alles, nämlich die gesamte Welt und ihre Geschichte. Dabei kommen beide immerzu von einem zum anderen, vom Hölzchen aufs Stöckchen — manchmal ist es der Klang bestimmter Wörter, der den Anschluss sichert, manchmal ein thematischer Zusammenhang, manchmal ein systematischer oder ein personaler. Das macht das Lesen so anstrengend und schwierig: Wie eigentlich immer bei Jelinek ist auch Rein Gold total überfrachtet. Man muss sich selbst eine Schneise durch diese Textlandschaft schlagen, seinen Weg suchen und dabei so manchen Irrgang nicht in Kauf nehmen. Dafür bekommt man eine Anklage der Macht, des auf (unbedienten) Schulden beruhenden Kapitalismus, der Ausbeutung überhaupt, dem Verhältnist von Männern und Frauen und dem von Töchtern und Väter im besonderen. Das ist oft witzig, treffend und genau, manchmal aber auch absurd und manisch, wie hier alles — also wirklich Gott und die Welt, schließlich ist Wotan ja nicht irgendwer, wie er gerne betont, und Brünhilde natürlich auch nicht — durch den Textwolf gedreht wird.
Ich verstehe noch immer nicht, was ich sage, muß es aber sagen. (210)
Dieses ewige Texband hat mir den Zugang hier vor allem auf den ersten paar Dutzend Seiten ziemlich erschwert: Wenn man nicht reinkommt in den Rhythmus der Gedanken und Worte, dann bleibt man aber auch wirklich draußen. Die schlechte Typographie macht das Lesen des unbändigen Textes allerdings auch nicht leichter und versagt damit total — die unpassende Type ohne Ligaturen ist der Anfang, dann ist der Satzzeichen-Clash „!,“, der oft vorkommt, erstaunlich hässlich und vor den Ausrufe- und Fragezeichen so viel Luft, dass man manchmal kaum weiß, wo die hingehören.
Es gibt nichts vom Geld Verschiedenes, denn es gibt nur Geld, es gibt Verschiedene, aber auch von ihnen kommt nur Geld, falls sie es schon vorher hatten, sonst sind sie gar nicht so verschieden. Sonst sind sie die gleichen wie wir. (89f.)
Alles Geld ist nichts ohne Ware, und die Ware ist nichts als ein beschnittener Jude, unvollständig, aber unbestreitbar tüchtig, immer tüchtig, das sehe ich voraus, bis auch er endet, ach, ich weiß nicht, das sage ich, ein Gott, und die Ware ist das Wunderbare, die Ware ist das Wunder, die wunderbare Vermehrung von allem, nicht nur Brot und Fischen, Jesus auch ein Pfosten, klar, verschenkt wird nichts, der hat das gemacht, aber er war ein Dillo, daß er geglaubt hat, das bringt ihm was, das bringt ihm Anhänger oder wie oder was, ich seh sie nicht, ich sehe sie noch nicht, was wollte ich sagen: Also die Ware ist das wundertätige Mittel, um aus Geld, das wandern muß, das zu einem bestimmten Zweck, nämlich diesem, wandern muß, sonst kann man sich dafür nichts kaufen, weil dann ja oft die Waren ganz woanders sind als das Geld, das eben wandern muß, um aus Geld mehr Geld zu machen, um mehr aus sich zu machen. Um aus Geld mehr Geld zu machen. Mehr Geld zu machen und aus. (125f.)
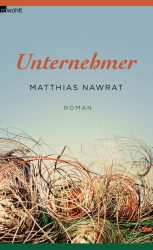 Der Schwarzwald in nicht allzu ferner Zukunft: deindustrialisiert, aufgegeben, verlassen, nur noch eine Restbevölkerung schaut zu, wie die riesigen Transporter auf der Autobahn vorbei nach Norden donnern, in die Städte. Da lebt auch die klassische Familie — Vater, Mutter, Tochter, Sohn — von Liba, der 13jährigen Erzählerin in Nawrats kleinem, aber durchaus feinen Roman Unternehmer. Die Familie, das ist der Witz, hat die Logik des Kapitalismus aufgesogen und übernommen, bis ins Letzte des Familienlebens hinein. Die Kinder sind damit Teil des Unternehmens — eines ziemlich dürftigen Resteverwerters, der in verlassenen Fabriken und Kraftwerken nach Wertstoffen sucht. Das ist eine nicht ganz ungefährliche Aufgabe, der Sohn hat schon einen Arm verloren und wird während des Romans auch noch seiner Beine beraubt. Nawrat führt hier also gewissermaßen die neoliberalistische Spielart des Kapitalismus nach dem Ende der Produktion vor. Und er zeigt wunderbar, wie hohl die Phrasen der Ideologie (geworden) sind. Dazu dient ihm eine faszinierende Sprache, die — wie die Motive der Erzählung — zwischen Naivität und Raffiniertheit, zwischen Spiel und tödlichem Ernst, zwischen Lockerheit und Strenge (in Ton und Satzbau gleichermaßen) pendelt. Gerade dadurch, dass nicht alles expliziert wird, sich der Leser einiges dieser seltsamen Welt und Gesellschaft und Familie zusammenreimen muss und auch oft genug auf Lücken stößt, bleibt Unternehmer interessant. Schön auch, dass Nawrat seine Idee dann auch nicht übermäßig auswalzt und sich mit 137 Seiten bescheidet — mehr ist auch überhaupt nicht nötig, der Punkt ist dann schon längst klar: “Unternehmertum” ist eine leere Worthülle, die man noch als Spiel betreiben kann, die aber, wenn sie zur alleinigen Ideologie geworden ist, die Leere ihrer selbst vorführt — und das Fehlen der “wahren” Werte wie Emotionen und Gefühle nur noch deutlicher werden lässt.
Der Schwarzwald in nicht allzu ferner Zukunft: deindustrialisiert, aufgegeben, verlassen, nur noch eine Restbevölkerung schaut zu, wie die riesigen Transporter auf der Autobahn vorbei nach Norden donnern, in die Städte. Da lebt auch die klassische Familie — Vater, Mutter, Tochter, Sohn — von Liba, der 13jährigen Erzählerin in Nawrats kleinem, aber durchaus feinen Roman Unternehmer. Die Familie, das ist der Witz, hat die Logik des Kapitalismus aufgesogen und übernommen, bis ins Letzte des Familienlebens hinein. Die Kinder sind damit Teil des Unternehmens — eines ziemlich dürftigen Resteverwerters, der in verlassenen Fabriken und Kraftwerken nach Wertstoffen sucht. Das ist eine nicht ganz ungefährliche Aufgabe, der Sohn hat schon einen Arm verloren und wird während des Romans auch noch seiner Beine beraubt. Nawrat führt hier also gewissermaßen die neoliberalistische Spielart des Kapitalismus nach dem Ende der Produktion vor. Und er zeigt wunderbar, wie hohl die Phrasen der Ideologie (geworden) sind. Dazu dient ihm eine faszinierende Sprache, die — wie die Motive der Erzählung — zwischen Naivität und Raffiniertheit, zwischen Spiel und tödlichem Ernst, zwischen Lockerheit und Strenge (in Ton und Satzbau gleichermaßen) pendelt. Gerade dadurch, dass nicht alles expliziert wird, sich der Leser einiges dieser seltsamen Welt und Gesellschaft und Familie zusammenreimen muss und auch oft genug auf Lücken stößt, bleibt Unternehmer interessant. Schön auch, dass Nawrat seine Idee dann auch nicht übermäßig auswalzt und sich mit 137 Seiten bescheidet — mehr ist auch überhaupt nicht nötig, der Punkt ist dann schon längst klar: “Unternehmertum” ist eine leere Worthülle, die man noch als Spiel betreiben kann, die aber, wenn sie zur alleinigen Ideologie geworden ist, die Leere ihrer selbst vorführt — und das Fehlen der “wahren” Werte wie Emotionen und Gefühle nur noch deutlicher werden lässt.
Die Garantie hierfür ist der Erfolg unserer täglichen Arbeit. Also hängt alles vom Erfolg unserer täglichen Arbeit ab, sagte Berti. Und diesen wiederum haben wir selbst in der Hand, sagte ich. Es handelt sich um einen Erfolgskreislauf, den wir mit unserer Arbeit in Bewegung halten.
 Zu diesem schönen und tollen Laufbuch oder besser: Läuferbuch eines außerordentlichen Läufers habe ich drüben im Laufblog schon alles notwendige gesagt: Viel Licht, ein bisschen Schatten: Leseempfehlung für alle Ultra-Trail-Lauf-Interessierten.
Zu diesem schönen und tollen Laufbuch oder besser: Läuferbuch eines außerordentlichen Läufers habe ich drüben im Laufblog schon alles notwendige gesagt: Viel Licht, ein bisschen Schatten: Leseempfehlung für alle Ultra-Trail-Lauf-Interessierten.
außerdem noch:
- Friedrich Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in Griechenland (Re-Lektüre, weil August ist)
