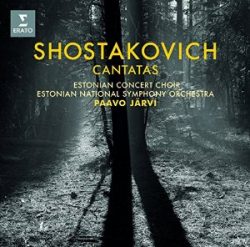Die Debatte um den Zustand der Lyrikkritik geht in die nächste Runde. Nun sind – mit einiger Verzögerung – die Metabeiträge dran: Jan Drees schreibt in seinem Blog eine gute Zusammenfassung der wesentlichen & wichtigsten Beiträge. Und Guido Graf weist beim Deutschlandfunk auf ein weiteres Spezifikum dieser inzwischen ja eigentlich eingeschlafenen Debatte hin: Der Streit, der sich unter anderem ja auch um das Problem der (zu) engen und intimen Verknüpfungen zwischen Lyrikerinnen und Kritikerinnen dreht und dabei nach den kritischen Standards und den Zielen einer möglichst (in verschiedenen Sinnen) wirksamen Lyrikkritik fragt, findet selbst in einem sehr engen, überschaubaren Zirkel (oder, wie man heute sagen würde, innerhalb der „Szene“) statt und scheint außer bei den mehr oder weniger direkt Beteiligten auf überhaupt keine Resonanz zu stoßen:
Interessant ist eben auch, wo diese aktuelle Debatte ausgetragen wird und wo nicht. Insbesondere dann, wenn man sie mit der letztjährigen über die Literaturkritik vergleicht, wie sie – auch online – hauptsächlich im Perlentaucher stattgefunden hat.
[…]Signaturen, Fixpoetry, Lyrikzeitung und immer wieder Facebook: Das sind die Orte, an denen debattiert wird. In den Feuilletons der Tageszeitungen, auf deren Online-Plattformen oder im Radio dazu kein Wort. Auch eine kundige Lyrik-Leserin wie Marie-Luise Knott verliert in ihrer Online-Kolumne beim Perlentaucher kein Wort über die aktuelle Debatte. Berührungslos ziehen die Dichter und ihre wechselseitigen Selbstbeobachtungen ihre Kreise.
Das ist in der Tat richtig beobachtet – und auch ausgesprochen schade. Man muss ja nicht unbedingt erwarten, dass die „großen“ Feuilletons der Debatte selbst viel Platz einräumen. Dazu ist der Kreis der daran Interessierten wohl einfach zu überschaubar. Aber dass sie die Existenz der Debatte – die ja schließlich auch ihr Métier, ihren Gegenstand (insofern sie überhaupt noch Lyrik besprechen …) betrifft – geradezu verschweigen, ist schon bedauerlich und sagt vielleicht mehr zum angenommenen/wahrgenommenen Zustand der Lyrik und ihrer Relevanz aus als alle Debatten. Guido Graf schlägt dann in seinem Schlusssatz als eine Art Lösung vor, „die Nischengrenzen zu verschieben“. Wie das zu erreichen ist, verrät er aber leider nicht – das hätte mich schon interessiert …