Dieses Mal eine lange, lange Liste, weil ich etwas nachlässig war und deshalb einiges nachtragen muss:
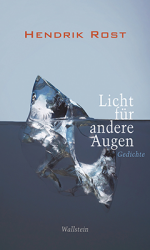 Schon die Widmung hat mich für diesen Lyrikband eingenommen: „Ein Wort hin, zwei Wörter her – viel mehr ist es oft nicht, aber das ist die Kunst. Jamas!“ (4) heißt es dort. Genau, so ist es.
Schon die Widmung hat mich für diesen Lyrikband eingenommen: „Ein Wort hin, zwei Wörter her – viel mehr ist es oft nicht, aber das ist die Kunst. Jamas!“ (4) heißt es dort. Genau, so ist es.
Und Rost gelingt es, die Kunst der Dichtung. Seine rhythmisch freien, ungereimten Gedichte, alle einzeln und von überschaubarer Länge, haben eine leichte Anmut, eine schwebende Wehmut ist ihnen eigen – so ungefähr lässt sich ihr Ton wohl fassen, vielleicht auch als Eleganz des Flusses der Sprache und der Bilder. Leere Räume (d.h. frei von Menschen, verlassen, aber nicht tot) scheinen ihn zu faszinieren, meint man am Anfang des Bandes. Aber das täuscht, die Menschen tauchen doch immer wieder auf, als Kind, auf Bildern, als Dialogpartner und als Tote/Geister aus der Vergangenheit (Brecht, Celan, Kling und viele andere werden auch namentlich herbeigerufen).
Überhaupt der Tod und die Vergangenheit: die sterbende Klarheit, aber auch die Trauer der Dinger behaupten immer wieder ihren Platz. So heißt es zum Beispiel in „Platzverweis“:
Manchmal ist die Traurigkeit eines Stuhls /nicht die Traurigkeit, die der Stuhl /ausstrahlt, sondern die /derjenigen, die auf ihm gesessen haben /vor Tagen, Jahren oder länger. (21)/
Das Schöne an Rosts Gedichte ist immer wieder das Sehen und Schreiben mit anderen Augen. Der Einfall des Alltags in die Kunst (und die (Lebens-)Philosophie), zugleich aber auch ganz deutlich die Gegenwart der – nicht nur literarischen – Vergangenheit(en): Das zeichnet sein Werk besonders aus.
 Der Auftakt ist gleich eine schöne Kontrafaktur oder Wiederaufnahme der Celanschen „Todesfuge“ in „Verfugtes Meisterstück“: Die Re-Grundierung im Alltag, die Entmystifizierung und Entzauberung der totalen Metapher – das klappt hier ganz gut. Überhaupt findet sich das in vielen Gedichten von Voß: Die unterschiedslose Gleichwertigkeit von Alltag mit seinen Banalitäten und absoluter Phantasie. Manchmal wendet sich das etwas arg ins punkige und trashige (für meinen Geschmack). Aber die Doppelgesichtigkeit – auf der einen Seite die hohe Sprache mit ausgesucht phantasievollen Metaphern und wilden Bildern, auf der anderen Seite aber auch (bewusste – nehme ich an) Plattheiten und flache Wörter und Sätze – stehen nebeneinander oder werden einander konfrontiert. Oft klingt das in meinen Ohren dann groß und leer zugleich, also etwas prätentiös. Manchmal scheint das aber auch großartig – aber eher selten, oft lässt mich das einfach kalt. Diese Gegensätze bilden oft schroffe, scharfkantige Unfälle, aus denen ich aber keine Funken schlagen kann und die mich – wie das meiste in diesem Band – ratlos und unbeteiligt lassen. (Und an die binär codierten Seiten-/Buchteil-/Gedichtzahlen kann ich mich gar nicht gewöhnen …)
Der Auftakt ist gleich eine schöne Kontrafaktur oder Wiederaufnahme der Celanschen „Todesfuge“ in „Verfugtes Meisterstück“: Die Re-Grundierung im Alltag, die Entmystifizierung und Entzauberung der totalen Metapher – das klappt hier ganz gut. Überhaupt findet sich das in vielen Gedichten von Voß: Die unterschiedslose Gleichwertigkeit von Alltag mit seinen Banalitäten und absoluter Phantasie. Manchmal wendet sich das etwas arg ins punkige und trashige (für meinen Geschmack). Aber die Doppelgesichtigkeit – auf der einen Seite die hohe Sprache mit ausgesucht phantasievollen Metaphern und wilden Bildern, auf der anderen Seite aber auch (bewusste – nehme ich an) Plattheiten und flache Wörter und Sätze – stehen nebeneinander oder werden einander konfrontiert. Oft klingt das in meinen Ohren dann groß und leer zugleich, also etwas prätentiös. Manchmal scheint das aber auch großartig – aber eher selten, oft lässt mich das einfach kalt. Diese Gegensätze bilden oft schroffe, scharfkantige Unfälle, aus denen ich aber keine Funken schlagen kann und die mich – wie das meiste in diesem Band – ratlos und unbeteiligt lassen. (Und an die binär codierten Seiten-/Buchteil-/Gedichtzahlen kann ich mich gar nicht gewöhnen …)
Nur keine Panik, es ist nur /ein Vulkan der da raucht /nicht der Kopf, der ist leer (Überall Kuscheltiere)
 Eine „real-time novel“ hat Coupland PlayerOne genannt, das als eine Art Vorlesung in fünf Stunden entstanden ist und dementsprechend auch fünf Teile aufweist. Es geht, wenig überraschend bei Coupland, um die Zukunft der Menschheit: Eine Gruppe zufällig zusammengewürfelter Menschen gerät in einer Flughafenbar in ein apokalyptisches Szenario, hier der Zusammenbruch der Ölversorgung (und damit der gesamten Energie) von einem Moment auf den anderen, mit den entsprechenden anarchischen und gewalttätigen Folgen, die noch durch ein paar andere Erzählstränge, die ihre eigene Dynamik und teilweise Gewalt bergen, überlagert werden. Das dient Coupland dann dazu, sich seinen Lieblingsthemen zu widmen: Wie sieht die Zukunft der Menschheit aus, wie die der Gesellschaft? Er erzählt das hier mit perspektivischem Fokus auf den einzelnen Personen, dekliniert also immer, in jeder „Stunde“, das vorhandene Personal durch – erweitert um den „Player One“, so etwas wie eine technisch-programmierte Identität einer der Charaktere. Außerdem verhandelt werden: Lebenswege, psychanalytische Deutungen und ganz stark das Problem der Zeit, ihr Tempo, ihre Linearität, ihr Fortschreiten und Anhalten …
Eine „real-time novel“ hat Coupland PlayerOne genannt, das als eine Art Vorlesung in fünf Stunden entstanden ist und dementsprechend auch fünf Teile aufweist. Es geht, wenig überraschend bei Coupland, um die Zukunft der Menschheit: Eine Gruppe zufällig zusammengewürfelter Menschen gerät in einer Flughafenbar in ein apokalyptisches Szenario, hier der Zusammenbruch der Ölversorgung (und damit der gesamten Energie) von einem Moment auf den anderen, mit den entsprechenden anarchischen und gewalttätigen Folgen, die noch durch ein paar andere Erzählstränge, die ihre eigene Dynamik und teilweise Gewalt bergen, überlagert werden. Das dient Coupland dann dazu, sich seinen Lieblingsthemen zu widmen: Wie sieht die Zukunft der Menschheit aus, wie die der Gesellschaft? Er erzählt das hier mit perspektivischem Fokus auf den einzelnen Personen, dekliniert also immer, in jeder „Stunde“, das vorhandene Personal durch – erweitert um den „Player One“, so etwas wie eine technisch-programmierte Identität einer der Charaktere. Außerdem verhandelt werden: Lebenswege, psychanalytische Deutungen und ganz stark das Problem der Zeit, ihr Tempo, ihre Linearität, ihr Fortschreiten und Anhalten …
Luke once thought time was like a river, and that it always flowed at the same speed, no matter what. But now he believes that time has floods, too – it simply isn’t a constant anymore. (70)
Those bodies bind us to the future. They’re time-frozen. Tomorrow = yesterday = today = the same thing, always. (110)
 Über einen Beitrag von Dieter M. Gräf (Erkundungen innerhalb und außerhalb der Maschine ja und nein. Neue und neu gebliebene Gedichte Walter Höllerers aus der Zeit der „Systeme“. In: Sprache im technischen Zeitalter, H. 203 (2012), S. 264–269) bin ich auf diesen Gedichtband Höllerers aufmerksam geworden – den ich als Lyriker bisher noch kaum kannte, sondern vor allem als Theoretiker, Interpret und Vermittler von Gedichtetem. Und das ist eine Schande, denn hier versammeln sich einige, sogar ziemlich viele ausgesprochen gute Gedichte – auch wenn man ihnen ihre Entstehungszeit, die 1960er Jahre, (inzwischen) in manchen Gedanken und Formulierungen sehr deutlich anmerkt. Aber das muss ja auch gar nicht schlecht sein …
Über einen Beitrag von Dieter M. Gräf (Erkundungen innerhalb und außerhalb der Maschine ja und nein. Neue und neu gebliebene Gedichte Walter Höllerers aus der Zeit der „Systeme“. In: Sprache im technischen Zeitalter, H. 203 (2012), S. 264–269) bin ich auf diesen Gedichtband Höllerers aufmerksam geworden – den ich als Lyriker bisher noch kaum kannte, sondern vor allem als Theoretiker, Interpret und Vermittler von Gedichtetem. Und das ist eine Schande, denn hier versammeln sich einige, sogar ziemlich viele ausgesprochen gute Gedichte – auch wenn man ihnen ihre Entstehungszeit, die 1960er Jahre, (inzwischen) in manchen Gedanken und Formulierungen sehr deutlich anmerkt. Aber das muss ja auch gar nicht schlecht sein …
Schon beim titelgebenden Gedicht „Systeme“ kann man wunderbar das Moment sehen und erfahren, das ich an Gedichten so schätze: wie die Signifikanten ins Tanzen kommen. Höllerer erreicht das hier oft durch das Mittel der extremen syntaktischen Verkürzung: Teiweise nur Wortbrocken, einzelne Worte ohne unmittelbaren syntaktischen Zusammenhang, die – auch in der räumlichen Anordnung auf dem Papier – miteinander in Beziehung treten und Sinn hervorbringen.
Da steckt auch viel Technik(kritik) und Technizität drin, nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Sprache und der Form (das ist wohl wenig überraschend beim Gründer der Sprache im technischen Zeitalter …). Manches scheint aber auch – aus heutiger Sicht – sehr zeitgebunden bzw. typisch für die Situation und Stimmung der Bundesrepublik am Ende der Sechziger. Etwa die politischen Elemente, das Moment der politisch-gesellschaftlichen Systemkritik aus/in der Mitte der Gesellschaft (na gut, vielleicht nicht ganz die damalige Mitte). Heute scheint mir das nur noch im Bereich der Kapitalismuskritik gängig zu sein – oder in kleineren, extremeren Randbereichen, die dann aber eher selten in so „elitären“ Formen wie dieser Lyrik (und ihrer Verortung durch das Erscheinen als „LCB-Editionen“ im (Literatur-)Betrieb) sich zeigen.
Ich mag Volker Brauns Prosa eigentlich sehr gerne. Dieser schmale Band hat mich allerdings nicht wirklich überzeugen oder begeistern können. Der titelgebende Dialog (der auch den meisten Umfang beansprucht) ist ziemlich schnell ziemlich lahm und langweilig. Vor allem lese ich da hauptsächlich Banalitäten und Phrasen aus Brauns BRD- und Wende-Kritik-Repertoire. Dafür sind die die kurzen Anekdoten, Erzählungen aus Teil III interessanter. In typischer Braun-Manier zeigen sie mit ihrer Konzentration auf eine Begebenheit, eine charakteristische Beobachtung noch einmal sein stilistisches Können. Aber auch hier bleibt mir das inhaltlich etwas arg rückschauend, verangenheitsorientiert: In/an der Gegenwart – der Wende/dem Umbruch (wie es bei Braun heißt) – werden nur die negativen Seiten gezeigt und dargestellt, es weht immer etwas Wehmut über das Scheitern des Experimentes DDR durch die Sätze, ohne dass sich positivere Ziele oder Utopien zeigen würden.
Nach der sogenannten Wende sah ich nur die Wendungen, und zwar der willfährigsten Leute, die sich also gleich blieben. (135)
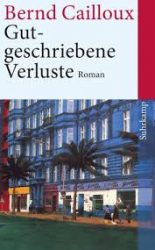 Ich habe hier am Anfang einen Moment gebraucht, bis mir klar wurde, warum mir einiges bekannt vorkam: Weil es in Figuren und Geschehen gewisse Ähnlichkeiten mit Das Geschäftsjahr 1968/69 von Cailloux gibt. Unabhängig von der Frage, ob hier ein alternder Autor autobiographisch erzählt (das scheint aber eines der Hauptinteressen der Rezensenten zu sein, die Decodierung, Entschlüsselung der auftauchenden Charaktere und Ereignisse) geht es in dieser rückblickender Vergegenwärtigung eines alte(rnde)n 68er (der damit aber auch wieder nur am Rande zusammenhängt, weil ihn an der Bewegung vor allem die Drogen, der Sex und die Geschäfte interessierten) vor allem um das Problem der fragmentierten Erinnerung, die sich auch im Text so niederschlägt. Manchmal fand ich das etwas mühsam, manchmal ist es spannend, manchmal aber auch etwas bemüht, doch meist aber locker und humorig parlierend erzählt. Altern und Erinnern – an bessere/beste Zeiten – sind also das Thema, angereichert mit Pop-/literaturhistorischen Artefakten. Aber so richtig reingefunden habe ich nicht, mir schien, das Cailloux hier doch arg viel Leerlauf produziert.
Ich habe hier am Anfang einen Moment gebraucht, bis mir klar wurde, warum mir einiges bekannt vorkam: Weil es in Figuren und Geschehen gewisse Ähnlichkeiten mit Das Geschäftsjahr 1968/69 von Cailloux gibt. Unabhängig von der Frage, ob hier ein alternder Autor autobiographisch erzählt (das scheint aber eines der Hauptinteressen der Rezensenten zu sein, die Decodierung, Entschlüsselung der auftauchenden Charaktere und Ereignisse) geht es in dieser rückblickender Vergegenwärtigung eines alte(rnde)n 68er (der damit aber auch wieder nur am Rande zusammenhängt, weil ihn an der Bewegung vor allem die Drogen, der Sex und die Geschäfte interessierten) vor allem um das Problem der fragmentierten Erinnerung, die sich auch im Text so niederschlägt. Manchmal fand ich das etwas mühsam, manchmal ist es spannend, manchmal aber auch etwas bemüht, doch meist aber locker und humorig parlierend erzählt. Altern und Erinnern – an bessere/beste Zeiten – sind also das Thema, angereichert mit Pop-/literaturhistorischen Artefakten. Aber so richtig reingefunden habe ich nicht, mir schien, das Cailloux hier doch arg viel Leerlauf produziert.
Was in er im Eigenbedarf verbrauchten Zeit passierte, war nur bedingt erzählenswert – in Filme reinkucken, Tabellen studieren, im Netz rumklichen, mal was lesen, denken, insbesondere denken, eine Primärtugend. (145)
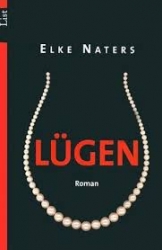 Naters zweiter Roman ist im Grunde eine Variation des ersten (Königinnen), aber ohne dessen formale Stärken. Wieder geht es um Freundschaft zwischen Frauen und um Beziehungsdramen. Das wird nun aber hier deutlich eindimensionaler erzählt. Die absichtlich beschränkte Sprache, der schlichte Stil – das bringt hier kaum mehr Schönheit oder Wahrheit hervor. Vorherrschend ist dagegen das Plätschern: Harmlose Oberflächen werden erzählt – natürlich absichtlich, das schlägt sich ja auch deutlich in Sprache und Form nieder -, die aber auch auf nichts (mehr) zu verweisen zu wollen scheinen und nur noch dem reinen Selbstzweck dienen. Das ist wenig, vor allem weil die Figuren blass bleiben und eigentlich – so weit ich das wahrnehme – langweilig sind. Man kann dem natürlich zugute halten, dass genau das gezeigt werden sollte: Dass es keine individuellen, „spannenden“ Lebensentwürfe mehr gibt und dass sie sich auch nicht mehr nach den klassischen Kriterien schön oder spannend erzählen lassen. Aber das ist eine zwar wahre, aber sehr trockene Einsicht, die hier irgendwie den Text nicht mehr trägt und rechtfertigt.
Naters zweiter Roman ist im Grunde eine Variation des ersten (Königinnen), aber ohne dessen formale Stärken. Wieder geht es um Freundschaft zwischen Frauen und um Beziehungsdramen. Das wird nun aber hier deutlich eindimensionaler erzählt. Die absichtlich beschränkte Sprache, der schlichte Stil – das bringt hier kaum mehr Schönheit oder Wahrheit hervor. Vorherrschend ist dagegen das Plätschern: Harmlose Oberflächen werden erzählt – natürlich absichtlich, das schlägt sich ja auch deutlich in Sprache und Form nieder -, die aber auch auf nichts (mehr) zu verweisen zu wollen scheinen und nur noch dem reinen Selbstzweck dienen. Das ist wenig, vor allem weil die Figuren blass bleiben und eigentlich – so weit ich das wahrnehme – langweilig sind. Man kann dem natürlich zugute halten, dass genau das gezeigt werden sollte: Dass es keine individuellen, „spannenden“ Lebensentwürfe mehr gibt und dass sie sich auch nicht mehr nach den klassischen Kriterien schön oder spannend erzählen lassen. Aber das ist eine zwar wahre, aber sehr trockene Einsicht, die hier irgendwie den Text nicht mehr trägt und rechtfertigt.
Das Leben ist banal. Mein Leben ist banal. Ich bin banal.
Das gibt mir noch eine Weile zu denken, obwohl mir gar nicht danach ist. (180)
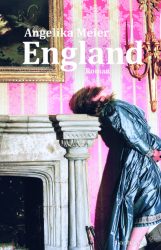 Angelika Meiers erster Roman ist nicht ganz so großartig wie Heimlich heimlich mich vergiss, aber trotzdem ein sehr gutes Buch. Es geht in einer reichlich verrückten Geschichte um eine Philosophin, der Wittgenstein erschienen ist und die dadurch auf die vergessenen und verschollenen Manuskripte eines Philosophen des 17. Jahrhunderts namens Manzanilla stößt, die in der Folge ihre Lebensaufgabe und ihr Lebenswerk werden – allerdings mit dem Problem, dass sie natürlich eine vollkommen offenkundige Fälschung sind.
Angelika Meiers erster Roman ist nicht ganz so großartig wie Heimlich heimlich mich vergiss, aber trotzdem ein sehr gutes Buch. Es geht in einer reichlich verrückten Geschichte um eine Philosophin, der Wittgenstein erschienen ist und die dadurch auf die vergessenen und verschollenen Manuskripte eines Philosophen des 17. Jahrhunderts namens Manzanilla stößt, die in der Folge ihre Lebensaufgabe und ihr Lebenswerk werden – allerdings mit dem Problem, dass sie natürlich eine vollkommen offenkundige Fälschung sind.
Wahnsinn und Realität verschwimmen in dieser Fabel vollkommen, die Fragen, was ist wirklich, was ist eingbildet? braucht man sich kaum mehr zu stellen – beantworten lassen sie sich sowieso nicht mehr. Schlaf, Geheimnis, Traum/Alptraum – alles geht durcheinander/ineinander und überkreuzt sich ständig in den Beeinflussungen udn Handlungen der Personen. Vor allem ist diese Geschichte zwischen Wittgenstein und Manzanilla, zwischen Vergangenheit(en) und Gegenwarten aber sehr unterhaltsam, vor allem wegen der skuril, aber sehr genau und liebevolle gezeichneten Figuren und Charakteren.
Überhaupt ist Meiers Roman sehr geistreich und oft mit schwarzem Humor gespickt, die Absurditäten und Verrücktheiten des (institutionalisierten) Denkens (und insbesondere des Denkens über Sprache) gewitzt und geschickt aufspießend: Wunderbar unterhaltend dabei, wahrscheinlich gerade wegen der Häufung der Skurilitäten, die sich selbst so absolut ernst nehmen können.
Sehen Sie, manche Philosophen – oder wie man sie nennen soll – leiden an dem, was man Problemverlust nennen kann. Es scheint Ihnen dann alles ganz einfach, und es scheinen keine tieferen Probleme mehr zu existieren, die Welt wird weit und flach und verliert jede Tiefe; und was sie schreiben, wird unendlich seicht und trivial. (91)
