–Sie wurden geboren, arbeiteten, und sie starben. Wäre Leben so=einfach so=kurz wie dieser Satz, Leben, wäre gewiß glückvoller. Leben aber dauert länger als 1 Satz. (31)
 Oben das Feuer, unten der Berg – an dem Buch ist nicht nur der Titel seltsam und rätselhaft. Ich bin ja eigentlich ein großer Bewunderer der Werke Reinhard Jirgls, aber mit diesem Roman kann ich wenig bis gar nichts anfangen. Das, was von einer Geschichte übrig ist, ist rätselhaft, schwankt zwischen Krimi und Verschwörungstheorie, Vergangenheitsbewältigung und Verbitterung. Die auftauchenden Figuren sind eigentlich lauter kaputte Menschen. Oder: Sie werden kaputt gemacht, durch das „System“, die Macht oder ähnliche Instanzen. Die grausame Brutalität der Welt, der Macht und der Mächtigen, die die Moral nur als Deckmantel und Beruhigung fürs Volk (wenn überhaupt) haben, benutzen – den ganzen Text durchdringt eine sehr schwarze, pessimistische Weltsicht. So weit, so gut (oder auch nicht, aber das ist ja erst mal egal). Fragwürdig bleibt mir aber doch einfach vieles. Auf dem Schutzumschlag steht etwa: „Titel, Textvolumen und Reihenfolge der Kapitel im Roman sind von dem altchinesischen Orakel I‑Ging bestimmt.“ – Zum einen: was soll das? Ich habe keine Ahnung … Zum anderen: Ich bezweifle fast, dass das überhaupt stimmt …
Oben das Feuer, unten der Berg – an dem Buch ist nicht nur der Titel seltsam und rätselhaft. Ich bin ja eigentlich ein großer Bewunderer der Werke Reinhard Jirgls, aber mit diesem Roman kann ich wenig bis gar nichts anfangen. Das, was von einer Geschichte übrig ist, ist rätselhaft, schwankt zwischen Krimi und Verschwörungstheorie, Vergangenheitsbewältigung und Verbitterung. Die auftauchenden Figuren sind eigentlich lauter kaputte Menschen. Oder: Sie werden kaputt gemacht, durch das „System“, die Macht oder ähnliche Instanzen. Die grausame Brutalität der Welt, der Macht und der Mächtigen, die die Moral nur als Deckmantel und Beruhigung fürs Volk (wenn überhaupt) haben, benutzen – den ganzen Text durchdringt eine sehr schwarze, pessimistische Weltsicht. So weit, so gut (oder auch nicht, aber das ist ja erst mal egal). Fragwürdig bleibt mir aber doch einfach vieles. Auf dem Schutzumschlag steht etwa: „Titel, Textvolumen und Reihenfolge der Kapitel im Roman sind von dem altchinesischen Orakel I‑Ging bestimmt.“ – Zum einen: was soll das? Ich habe keine Ahnung … Zum anderen: Ich bezweifle fast, dass das überhaupt stimmt …
In den faszinierenden, genauen, poetischen (d.i. lyrischen) Beschreibungen, ja, der geradezu überbordenden Beschreibungsgenauigkeit liegt vielleicht die größte Stärke des Romans, auch durch die Spezialorthografie, die nämlich Möglichkeiten und Deutungen der Sprache verdeutlichen, vereindeutigen oder überhaupt erst eröffnen kann. Auf der anderen Seite hatte ich oft den Eindruck eines „verwilderten“ Text, der sich von sich selbst treiben lässt und der im Zickzack-Kreis des Erzählens „der“ Geschichte keine wie auch immer geartete Ordnung gelten lässt (zumindest keine, die ich erkennen könnte). Seltsam finde ich auch: Eigentlich passiert das meiste des Romans auf privater, ja intimer Ebene. Aber dann will der Roman doch die ganz großen Themen behandeln (z.B. die Macht und die Moral) – das passiert dann (damit es jeder merkt) v.a./nur durch das neunmalkluge Dozieren der Figuren, in deren Erkenntnissen, in deren Durchschauen der Welt und der Verschwörungen) sich der Erzähler (und vielleicht auch der Autor) zu allem und jedem äußern kann, seine Position als wahre absichern und mitteilen kann.
?Wo in alldieser unermeßlichen=Unendlichkeit blieb eigentlich ?mein Webfaden, ?meine=!ureigene Spur, die mich etwas Unverwechselbares in dieses unerschöpfliche Lebenswischhadergefilz hätte hin1prägen lassen. (230)
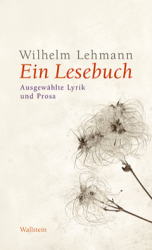 Auf Wilhelm Lehmann bin ich erst durch die zweite Ausgabe des Gelben Akrobaten von Michael Braun und Michael Buselmeier aufmerksam geworden. Lehmann, der von bis vor allem an der Küste lebte, war als Lehrer sowohl ein ausgezeichneter Naturbeobachter als auch ein starker Dichter, wie ich anhand des Lesebuchs leicht feststellen konnte. Dort bieten die drei Herausgeber eine Auswahl aus der mehrbändigen Werkausgabe: (viel) Lyrik, etwas aus den Tagebüchern, einige Auszüge aus theoretischen/poetologischen Essays und ein wenig Prosa. Inwieweit das ein repräsentatives Bild abgibt, kann ich nicht beurteilen. Sagen kann ich nur, dass das, was ich hier gelesen habe, faszinierende Momente hat. Die mich am meisten berührenden Texte und Passagen waren wohl die, wo sich der penible und wissende Naturbeobachter mit dem bildkräftigen Lyriker verbindet.
Auf Wilhelm Lehmann bin ich erst durch die zweite Ausgabe des Gelben Akrobaten von Michael Braun und Michael Buselmeier aufmerksam geworden. Lehmann, der von bis vor allem an der Küste lebte, war als Lehrer sowohl ein ausgezeichneter Naturbeobachter als auch ein starker Dichter, wie ich anhand des Lesebuchs leicht feststellen konnte. Dort bieten die drei Herausgeber eine Auswahl aus der mehrbändigen Werkausgabe: (viel) Lyrik, etwas aus den Tagebüchern, einige Auszüge aus theoretischen/poetologischen Essays und ein wenig Prosa. Inwieweit das ein repräsentatives Bild abgibt, kann ich nicht beurteilen. Sagen kann ich nur, dass das, was ich hier gelesen habe, faszinierende Momente hat. Die mich am meisten berührenden Texte und Passagen waren wohl die, wo sich der penible und wissende Naturbeobachter mit dem bildkräftigen Lyriker verbindet.
Aus vielen der Naturbeschreibungen der Gedichte spricht eine leise Wehmut: Die Natur ist für Lehmann ganz offenbar ein Ort, an dem die göttliche/geschöpfte/schöpferische Ordnung noch gilt und dann auch zu beobachten ist; sie bleibt vom Chaos, der Gewalt und dem Schmerz der Menschen (den sich die Menschen gegenseitig (und ihr) zufügen) unberührt. Solche Lyrik ist, wie er es in einem Aufsatz einmal auf den Punkt bringt: „Poesie als Einwilligung in das Sein“.
Gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges scheint sich das aber zu ändern: Zunehmend werden Natur und Menschenwelt/Zeitgeschichte im Gedicht konfrontiert, meist nebeneinander gestellt (sozusagen ohne tertium comparationis): Hier die gleichförmige (im Sinne von in einem festen Rhythmus sich wiederholende), vertraute (d.h. auch: lesbare, entschlüsselbare, verstehbare) Natur, dort der unerhörte Schrecken, das ungesehene und ungeahnte Grauen des Weltkriegs. Das bleibt aber immer sehr subtil und – gerade in den Beschreibungen und Schilderungen – sehr kunstvoll, in fein austarierten Rhythmen und mit oft sehr harmonisch, fast selbstverständlich wirkenden Reimen ausgearbeitet. Am besten verdeutlicht das vielleicht ein Gedicht wie „Fallende Welt“:
Das Schweigen wurde
Sich selbst zu schwer:
Als Kuckuck fliegt seine Stimme umher.Mit bronzenen Füßen
Landet er an,
Geflecktes Kleid
Hat er angetan.Die lose Welt,
Wird sie bald fallen?
Da hört sie den Kuckuck
Im Grunde schallen.Mit schnellen Rufen
Ruft er sie fest.
Nun dauert sie
Den Zeitenrest.
 Der Verlag nennt die auf der Opernbühne spielende Novelle von Sabine Bergk „Übertreibungsliteratur”. Das stimmt natürlich, trifft den Kern des vor allem phantastischen und absurden Textes aber nur halb. Gilsbrod ist eine Ein-Satz-Novelle mit 130 Seiten ungebrochenem stream of consciousness. Das ist natürlich nicht völlig neu, spontan fällt mir aus letzter Zeit etwa Xaver Bayers Wenn die Kinder Steine ins Wasser werfen (2011) ein, das ähnlich funktioniert. Hier, also in Gilsbrod, lesen wir das Bewusstsein einer Opernsouffleuse, die im entscheidenden Moment der Theaterdiva nicht aushilft und sie deshalb in eine improvisierte Kadenz auf dem falschen Text treibt. Ein Ende hat der Text nicht, er bricht einfach ab. Bis dahin ist er aber dicht und unterhaltsam, phantastisch und absurd, traurig und komisch zugleich. Oder zumindest abwechselnd. Den natürlich lässt sich so ein Bewusstsein hin und her treiben, das ist eine heftige Mischung von Vergangenheiten und Gegenwarten, Realitäten und Träumen, Wünschen und Ängsten, geschichtet und überlagert, auch mit Versionen der (pseudo-)Erinnerung versehen, der seine Ebenen im kreisenden Wiederholen herauskristallisiert.
Der Verlag nennt die auf der Opernbühne spielende Novelle von Sabine Bergk „Übertreibungsliteratur”. Das stimmt natürlich, trifft den Kern des vor allem phantastischen und absurden Textes aber nur halb. Gilsbrod ist eine Ein-Satz-Novelle mit 130 Seiten ungebrochenem stream of consciousness. Das ist natürlich nicht völlig neu, spontan fällt mir aus letzter Zeit etwa Xaver Bayers Wenn die Kinder Steine ins Wasser werfen (2011) ein, das ähnlich funktioniert. Hier, also in Gilsbrod, lesen wir das Bewusstsein einer Opernsouffleuse, die im entscheidenden Moment der Theaterdiva nicht aushilft und sie deshalb in eine improvisierte Kadenz auf dem falschen Text treibt. Ein Ende hat der Text nicht, er bricht einfach ab. Bis dahin ist er aber dicht und unterhaltsam, phantastisch und absurd, traurig und komisch zugleich. Oder zumindest abwechselnd. Den natürlich lässt sich so ein Bewusstsein hin und her treiben, das ist eine heftige Mischung von Vergangenheiten und Gegenwarten, Realitäten und Träumen, Wünschen und Ängsten, geschichtet und überlagert, auch mit Versionen der (pseudo-)Erinnerung versehen, der seine Ebenen im kreisenden Wiederholen herauskristallisiert.
Das funktioniert recht gut, weil die Sprecherin aus der Position des unsichtbaren/unscheinbaren Beobachters, der Souffleuse, agiert. In der Privatmythologie wird der dienend-unterstützende Hilfsdienst dieser Funktion für das Theater, genauer: die Oper, zur mystischen Erfahrung hochstilisiert, zum erfüllenden Lebenstraum. Es wird aber durchaus auf geschickte und untergründige, aber erkennbare Weise auch die eigene Position reflektiert, zum Beispiel im Verlust der Rest-Sichtbarkeit durch den mittigen Souffleurkasten und die Verbannung auf die Seitenbühne, die nicht gleichermaßen Teil der Aufführung ist: dort unterhalten sich Techniker und wartende Sänger während der Oper … Zugleich zu dieser wahrgenommenen Marginalisierung – im Kontrast dazu und zu den Erinnerungen der präfigurierenden Demütigungen der Schulzeit (die sehr seltsam als eine Art Kreuzigung am Rutschengerüst erinnert werden, mit Lanze und Essig und allem drumherum …) ist der Bewussstseinsstrom aber auch die Konstruktion einer totalen Machtposition: von ihr ist alles, insbesondere eben die Diva Gilsbrod abhängig – und damit das ganze Theater, die Stadt, das Publikum: „mir gehört der Text“ (39).
Der Text ist aber nicht ohne Dramaturgie gebaut, zum Beispiel verschränken und vermischen sich die diversen Zeiten und Ebenen immer mehr. Auch das „Vordringen“ in die Figur „Gilsbrod“ wird geschickt zeichenhaft genutzt: Es beginnt an der Grenze zwischen außen und innen des Körpers, den Zähnen der Sängerin, und dringt über den Mundraum immer weiter vor/hinein …
Im Grunde ist Gilsbrod eine große Rachephantasie, die ja auch zu keinem Ende kommt: der Bewusstseinsstrom bricht in der großen (falschen!) Kadenz der Gilsbrod ab, das „non so d’amarti“ verdichtet sich, bis zu einer Art Mantra – wenn man das hinzuzieht, könnte es natürlich auch eine (unbewusste) Liebesphantasie sein: „Ich weiß nicht, dass ich dich liebe“ …
[…] und deshalb gehen die Leute ja ins Theater, weil sie nicht alleine lachen wollen und sonst die anderen denken, sie wären verrückt, wie sollen sie auch lachen, wenn sie niemanden zum Lachen haben, und so bleiben sie lieber allein in ihrem Kummer, dabei ist es viel besser, gemeinsam zu weinen und die Leute gehen ja ins Theater, damit sie gemeinsam lachen und auch weinen können, wie auf der Beerdigung, sie beerdigen ihren Kummer im Theater und beerdigen sich selbst, vorzeitig, sie beerdigen sich gegenseitig und beerdigen alles, was ist, sie beerdigen die Langeweile, das Leben und die Hoffnung der Figuren, die Flugversuche und die Wetterwechsel, sie beerdigen das Licht hinter den Vorhangdecken wie zum Schlaf und zum Abschluss gibt es rauschenden Applaus und niemand denkt, dass sie verrückt sind, auch wenn alle nach vorne starren […] (69)
Ein ganzer Roman als Palindrom, ein Palindrom als Roman – geht das? Ein paar meiner Lektürebeobachtungen zu dieser Frage und anderen, die mich beim Lesen von Meyers Husarenstück bewegten, habe ich schon vor einigen Tagen hier notiert.
 Eine große – und außerdem auch noch autorisierte – Biografie der großen Jazzpianistin Irène Schweizer wollte Christian Broecking (den ich vor allem als Autor/Interviewpartner seiner beiden Respect-Bände kenne) hier wohl vorlegen. Rausgekommen ist ein mühsamer Brocken. Den Broecking schreibt auf den immerhin fast 500 Seiten vielleicht (gefühlt zumindest) ein Dutzend Sätze selbst. Diese Biografie ist nämlich gar keine, es gibt keinen Erzähler und eigentlich auch keinen Autor. An deren Stellen treten (fast) nur Quellen, das heißt Zeitzeugen, deren Aussagen zu und über Irène Schweizer aus Interviews hier grob sortiert wurden und höchstens mit einzelnen Sätzen notdürftig zusammengeflickt werden. Der dokumentarische Anspruch – die anderen also einfach erzählen zu lassen (aber auch die Fragen streichen, was manchmal seltsame „Texte“ ergibt) – geht dann auch so weit, dass englischsprachige Antworten nicht übersetzt werden. Viel Material wird also mehr oder weniger sinnvoll gereiht. Nach herkömmlichen Maßstäben ist das eher die Sammlung, die Vorarbeit zu einer eigentlichen Biografie, die das (ein-)ordnend und deutend erzählen würde.
Eine große – und außerdem auch noch autorisierte – Biografie der großen Jazzpianistin Irène Schweizer wollte Christian Broecking (den ich vor allem als Autor/Interviewpartner seiner beiden Respect-Bände kenne) hier wohl vorlegen. Rausgekommen ist ein mühsamer Brocken. Den Broecking schreibt auf den immerhin fast 500 Seiten vielleicht (gefühlt zumindest) ein Dutzend Sätze selbst. Diese Biografie ist nämlich gar keine, es gibt keinen Erzähler und eigentlich auch keinen Autor. An deren Stellen treten (fast) nur Quellen, das heißt Zeitzeugen, deren Aussagen zu und über Irène Schweizer aus Interviews hier grob sortiert wurden und höchstens mit einzelnen Sätzen notdürftig zusammengeflickt werden. Der dokumentarische Anspruch – die anderen also einfach erzählen zu lassen (aber auch die Fragen streichen, was manchmal seltsame „Texte“ ergibt) – geht dann auch so weit, dass englischsprachige Antworten nicht übersetzt werden. Viel Material wird also mehr oder weniger sinnvoll gereiht. Nach herkömmlichen Maßstäben ist das eher die Sammlung, die Vorarbeit zu einer eigentlichen Biografie, die das (ein-)ordnend und deutend erzählen würde.
Dadurch ist das vor allem eine Arbeitsbiographie und/oder ein Musiktagebuch: Wer wann mit wem wo gespielt hat, das gibt den Rahmen für die Lebensbeschreibung ab. Aber selbst das geht mit der Zeit und den Seiten der unendlichen Reihen von Konstellationen und Orten zunehmend unter, weil es einfach zu viel ist. Menschen kommen kaum/nicht vor, nur Funktionen: Musiker, Künstler, Organisatoren, Labelchefs und (wenige) Journaliste) – deshalb bietet das Buch auch nur Innensichten aus dem Umfeld Schweizers. Und Broecking hilft durch seine Abwesenheit als Autor eben auch nicht: Einen außenstehenden/neutralen (oder wenigstens pseudo-objektiven) Beobachter kann der Text nicht aufweisen. Ich denke, daraus rühren dann auch andere Schwächen. Vieles bleibt einfach ohne Erklärung. Und wenn ich keine Erklärung bekomme, brauche ich auch keine Biografie …
Zum Beispiel wird die Größe Schweizers zwar immer wieder beschworen, sie bleibt dabei aber ausgesprochen unklar, ohne Konturen und ohne Grund. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Musik in den (sowieso äußerst knappen) Beschreibungen (Analysen kommen mit Ausnahme des zehnseitigen Anhangs „Jungle Beats“ von Oliver Senn & Toni Bechtold, der anhand exemplarisch ausgewählter Aufnahmen Schweizers Musik, ihren Personalstil beschreibt, fast überhaupt nicht vor) selbst so generisch bleibt: frei improvisiert, dann wird mal dieser Einfluss (Cecil Taylor etwa) hervorgehoben, dann mal der jener betont (Monk etwa). Und immer wieder wird von den Interviewten darauf hingewiesen, dass sie keine Noten mag. Aber was sie wie spielt, kann man halt nicht so recht lesen, nur in verstreuten Hinweisen und Andeutungen (die auch eher ihre Präsenz und Energie auf der Bühne betreffen). Auch die ausgewählten Zitate aus Kritiken und Presseberichten bleiben erschreckend generisch. Ähnlich ist es um die politische Dimension des Lebens von Irène Schweizer und ihrer Musik bestellt: Beides wird vor allem behauptet („diese Musik ist politisch“), aber wie und warum, das steht nirgends, das wird nicht erklärt (und gerade da würde es (für mich) spannend werden …). Das alles führt dazu, dass mich die Lektüre etwas unbefriedigt zurückgelassen hat: Sicher kommt man um diesen Band kaum herum, wenn man sich mit Schweizer und/oder ihrer Musik befasst. Aber Antworten kann er kaum geben.
außerdem gelesen:
- Katharina Röggla: Critical Whiteness Studies und ihre politischen Handlungsmölichkeiten für Weiße AntirassistInnen. Wien: mandelbaum kritik & utopie 2012 (Intro. Eine Einführung). 131 Seiten.
- Selma Meerbaum-Eisinger: Blütenlese. Gedichte. Stuttgart: Reclam 2013. 136 Seiten.
- Monika Rinck: Wir. Phänomene im Plural. Berlin: Verlagshaus Berlin 2015 (Edition Poeticon 10).




